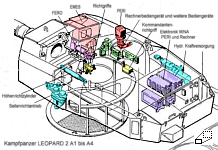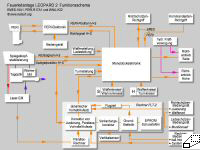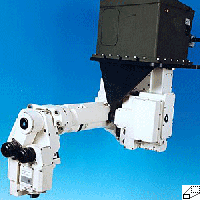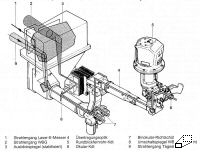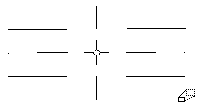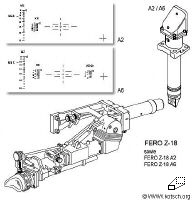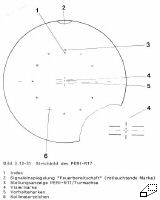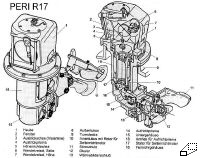|
Inhalt: |
Leopard 2
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Überblick
Nachtsichtgeräte Zielfernrohre 9K112 KOBRA 9K116 BASTION 9K119 REFLEKS T-54 / T-55 T-55AM T-55AM2 T-62 T-64 T-72 T-72B3 M-84 PT-91 T-80B T-90A STRV-103 IKV-91 AMX-30B AMX-30B2 Centurion Chieftain Panzer 68 Panzer 68/88 Leclerc Kürassier Kürassier A2 MBT-70 M48A1 M60A3 M1A1 Leopard 1A2 Leopard 1A4 Leopard 1A5 Leopard 2 |
Die Feuerleitanlage des Kampfpanzers Leopard 2
Die Feuerleitanlage des Leopard 2 umfasst als Hauptbaugruppen
das Tagzielfernrohr mit Laser-Entfernungsmesser und Wärmebildgerät,
eine gemeinsame Ausblickbaugruppe mit in zwei
Ebenen stabilisierter Visierlinie, den ballistischen Rechner, die Waffennachführanlage,
ein telekopisches Hilfszielfernrohr, ein stabilisiertes Kommandantenrundblickzielfernrohr
und die entsprechenden Elektronikblöcke. Die Unterbringung der
Hauptbaugruppen zeigt Bild 1. Ein vereinfachte
Funktionsschema der gesamten Anlage ist auf Bild 2dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
sind auf dem Schema nicht dargestellt: die Zentrallogik und
Hauptverteilung ZL/HV und das rechnergestütze Panzerprüfgerät
RPP. Als Hauptzielfernrohr wird das bei STN-Atlas Elektronik hergestellte EMES-15 mit 12facher Vergrößerung bei einem Sichtfeld von 5 Grad verwendet. Es integriert ein binokulares Tagsichtzielfernrohr, ein Wärmebildgerät und einen Laserentfernungsmesser in einer Baugruppe. Ein baugleiches Gerät wird auch im Leopard 1A5 verwendet. Im Bild 3 wird die komplette Baugruppe des EMES dargestellt. Im grünen Gehäuse ist die Spiegelbaugruppe mit ihrer Stabilisierungselektronik, sowie den Kreiseln, Resolvern und Stellmotoren untergebracht. Darunter befinden sich der Laser-Entfernungsmesser und das Wärmebildgerät, dessen Sichtfeld in den Strahlengang des Tagkanals eingespiegelt werden kann. Dazu ist ein mechanischer Umstellhebel zu betätigen. Am Rohr des Fernrohrteils befindet sich die gemeinsame Okularbaugruppe. Über ein optisches Verbindungsrohr kann der Kommandant im PERI-R17 das Sichtfeld des Richtschützen einsehen und notfalls über das EMES von seinem Platz das Feuer führen. Die Strahlengänge der Optiken zeigt das Bild 4. Das EMES-15 besitzt einen in zwei Ebenen stabilisierten Ausblickkopf für den Tages- und den Nachtsichtkanal sowie für den Laserentfernungsmesser. Die Stabilisierung der Kanone und des Turmes sind an die Primärstabilisierung des Ausblickkopfes gekoppelt. Über den Feuerleitrechner und weitere elektronische Baugruppen der Waffenstabilisierung folgt die Sekundär-Stabilisierung des Turmes und der Kanone der Primär-Stabilisierung des Ausblickkopfes. Die Schussverblockung gibt die Abfeuerung nur frei, wenn sich die Visierlinie des EMES und die Seelenachse der Kanone in der jeweiligen Soll-Lage befinden. Winkelgeber messen permanent die Abweichung der Waffenanlage zur Lage der Visierlinie in der Horizontalen und in der Vertikalen und führen Turm und Kanone ständig wieder in die Soll-Lage zurück. Deshalb spricht man hier auch von einer Waffennachführanlage. Der entscheidende Vorteil, neben der hohen Stabilisierungsgüte, besteht darin, dass über den Feuerleitrechner gesteuert, Turm und Kanone unabhängig vom primär stabilisierten Ausblickkopf des EMES aus der ursprünglichen in eine andere Soll-Lage geführt werden können. Somit können die vom Feuerleitrechner ermittelten Vorhaltewerte und Rohrerhöhungen automatisch umgesetzt werden, ohne dass der Richtschütze den Haltepunkt verändern muss. Er hat lediglich das Ziel mit der zentralen Richtmarke abzudecken und zu begleiten. Ist die Feuerleitanlage feuerbereit, wird das im Sichtfeld des Zielfernrohrs angezeigt und der Richtschütze kann abfeuern. Im Bild 5 ist das Strichbild im Sichtfeld des EMES-15 zu sehen. Ziele werden grundsätzlich mit der ringförmigen zentralen Richtmarke angerichtet. Die weiteren Striche können bei Bedarf zur behelfsmäßigen Ermittlung von Entfernungen nach dem militärischen Strichmaß und bei der Korrektur von Fehlschüssen verwendet werden. Bei funktionierender Feuerleitanlage soll der Richtschütze jedoch auch den Folgeschuss mit dem gleichen Haltepunkt abfeuern, so die geltende Regel. Am unteren Rand des Sichtfeldes wird die Entfernung und die gewählte Geschossart angezeigt, sowie die Schussfreigabe in Form des Buchstabens "F". Bei Verblockung der Schussfreigabe infolge zugroßer Abweichung der Sollage der Kanone zur Visierlinie wird eine "0" angezeigt. Bild 6 zeigt die Frontseite des
EMES-15 mit dem Okularteil und dessen Einstelleinrichtungen.
Rechts davon ist das Richtschützenbediengerät angebracht. An
ihm befindet sich oben Anzeigeleuchten für die Betriebsstufen,
darunter folgen die Einstellelemente für die Justierung auf
1500 m, die Feldjustierung, für das Wärmebildgerät, den Driftabgleich,
den Waffenartschalter Kanone/MG und die Dimmer für Strichplatten-
und Anzeigenbeleuchtung. Bild 7 zeigt den Richtgriff und den
Turmstellungsanzeiger.. Der Richtgriff enthält mehrere Schalter.
Das sind im einzelnen die Abfeuerung, die mit den Zeigefingern
betätigt wird, der Taster für den dynamischen Vorhalt, der mit
den Daumen niedergedrückt wird, der Sicherheitstaster
für die Richtanlage, der mit den Fingern beim Umfassen betätigt
wird und erst dann das Richten freigibt, sowie die Wipptaste
für die Entfernungsmessung an der Oberseite der Richtgriffe.
Beim Betätigen der Wippe nach links wird der Laser-Entfernungsmesser
ausgelöst, bein Betätigen der Wippe nacht rechts wird die Entfernung
auf E=1000 m umgestellt, falls eine exakte Messung unmöglich
ist und mit der Kampfentfernung geschossen werden soll. Dabei
verläuft der aufsteigende und der absteigende Ast der Flugbahn
beim Haltepunkt Zielmitte und einer Zielhöhe von 2 m bis etwa
2000 m stets durch das Ziel, was in diesem Entfernungsbereich
immer einen Treffer ermöglicht. Wird die rechte Wippe
zweimal hintereinander betätigt, wird auf die zuletzt gemessene
Entfernung zurückgeschaltet. Der digital arbeitende Feuerleitrechner liest
aus den
Speichermodulen alle zur Berechnung nötigen ballistischen Werte der
einzelnen Munitionssorten. Die Hauptmunitionssorten für Gefechtseinsatz
und das Übungsschießen sind bereits verfügbar und können
recht einfach durch Wechsel des Speichermoduls an neue Entwicklungen angepasst
werden. Bei der Vorbereitung des Schießens müssen von der Besatzung
die für jede Kanone und Munitionsart beim Werksanschuss ermittelte
individuellen Abweichung des mittleren Treffpunkts, dem sogenannten Systemfehler,
einer Schußserie jeder Geschossart vom Hauptjustierpunkt am Eingabepult eingestellt werden. Ebenso werden vorher
die Werte Lufttemperatur, Ladungstemperatur und die topografische Höhe
des Einsatzgebietes, als Referenzwert für den Luftdruck, eingestellt. Der Wert für den Seitenwind wird vorab
bei fester Einsatzrichtung eingestellt. Anfangs wurde der Seitenwind durch einen Sensor
permanent ermittelt. Auf den Seitenwindsensor wurde in späteren Baulosen
verzichtet. Bei Notwendigkeit
wird über einen Korrekturwert die Verringerung der Anfangsgeschwindigkeit wegen des Rohrverschleißes
eingestellt, da der Rohrverschleiß andernfalls zu einer geringeren Schussweite führt.
Während des Schießens ermittelt ein Sensor die Verkantung des
Turmes in der Querachse. Ein Abweichen von der Waagerechten führt zu großen
Abweichungen beim Schießen und kann durch Verändern der Soll-Lage
der Waffenanlage durch den Feuerleitrechner kompensiert werden. Für
die Vorhaltewerte beim Schießen auf sich bewegende Ziele und beim
Schießen aus der Bewegung werden durch Sensoren die Winkelgeschwindigkeiten
der Waffenanlage beim Begleiten des Zieles in der Horizontalen und in der
Vertikalen ermittelt. Der Feuerleitrechner kann aus diesen Werten die Vorhalten
in Höhe und Seite errechnen und die Waffenanlage über die Richtantriebe
entsprechend in eine neue Soll-Lage führen, während der Ausblickspiegel
des EMES über die Eigenstabilisierung seine Position beibehält. Auch im Wärmebildzielfernrohr (WBG) ist das gleiche
Strichbild wie im Tagkanal wiederzufinden, einziger Unterschied ist der fehlende zentrale
Ring. Das WBG wird von der Firma Zeiss-Eltro Optronik auf der Grundlage
eines Standard US-Moduls hergestellt. Der grundlegende Aufbau ist im Artikel
über die Nachtsichtgeräte beschrieben. Die Zeit bis
zum Erreichen der Betriebsbereitschaft beträgt cirka 10 Minuten, während
dieser Zeit wird der aus 120 Kadmium-Quecksilber-Tellur-Elementen (CdHgTe)
bestehende Detektor auf minus 196 Grad Celsius heruntergekühlt. Es
ist möglich die Vergrößerung des WBG zu verändern.
Zum Anrichten wird die 12fache Vergrößerung verwendet, zum weiträumigen
Beobachten kann auf 4fache Vergrößerung umgeschaltet werden.
In diesem Fall zeigt ein rechteckiger Rahmen das Sichtfeld der 12fachen
Vergrößerung an, dadurch kann der Richtschütze erkannte
Ziele schneller anrichten um danach die Vergrößerung umzustellen.
Bei Bedarf kann die Polarität der Anzeige umgestellt werden. Warme
Objekte werden entweder hell oder dunkel dargestellt, es handelt sich faktisch
um ein "Negativ" des vorherigen Bildes. Ebenso kann der Kontrast nachgestellt
werden um die Sichtbarkeit der Objekte zu verbessern. Die Bilddarstellung
des Wärmebildgerätes wird über einen optischen Kanal direkt
in das Sichtfeld des Tagkanals eingeblendet. Mit einem Umstellhebel
rechts der Okularbaugruppe kann dann wahlweise zwischen Tag-
und Wärmebildkanal umgeschaltet werden ohne die Augen von den
Okularen zu entfernen. In den Leopard 2A1 bis 2A4 ist das PERI-R17
des Kommandanten über einen optischen Kanal mit der Okularbaugruppe
des EMES verbunden. Das ermöglicht es dem Kommandanten, neben
dem EMES-Tagkanal auch das Wärmebildgerät des Richtschützen
zur Beobachtung und Feuerführung zu nutzen Bei Beschädigung des Hauptzielfernrohres kann das Feuer mit Hilfe eines teleskopischen Zielfernrohres mit achtfacher Vergrößerung vom Typ FERO-Z18 geführt werden. Bild 10 zeigt das Okular des FERO links vom Okularteil des EMES. Dieses Zielfernrohr ist achsparallel zur Kanone angebracht und hat einen Ausblick durch die Walzenblende. Es ist analog dem TZF-3 des Leopard 1 aufgebaut. Die Baulose bis zum Leopard 2A4 sind mit dem FERO-Z18 ausgestattet.
Wegen der keilförmigen Zusatzpanzerung an der Turmfront ab den
Baulosen Leopard 2A5 musste das Objektiv des FERO-Z18 aus der
Walzenblendenfront an die Oberseite der Walzenblende verlegt
werden. Das Bild 12 ermöglicht einen Blick auf die Oberseite
der Walzenblende
des Leopard 2A5. Links vom kastenförmigen Block des Ausblickteils
des EMES, auf dem beweglichen Teil der Walzenblende, ist der
nach oben verlegte, gepanzerte Ausblick des modifizierten FERO-Z18A2 zu erkennen.
Dazu wurde vor das ursprüngliche Objektiv des FERO eine senkrechte
optische Verlängerung eingebaut, wie sie Bild 11 zeigt. Der Kommandant des Leopard 2 verfügt über 6 großflächige Winkelspiegel in einer starren Kuppel. Als vergrößerndes Sichtgerät für die Rundumbeobachtung und Zielbekämpfung ist in der Turmdecke links vor der Kuppel das monokulare Rundblickperiskop PERI-R17A1 eingebaut. Es besitzt eine in zwei Ebenen stabilisierte Visierlinie und verfügt über eine zwei und achtfache Vergrößerung bei einem Sichtfeld von 27 Grad bzw. 7 Grad, je nach eingestellter Vergrößerung. Es ist die Weiterentwicklung des PERI-R12, das im Leopard 1A4 verwendet wurde und von dem wesentliche Baugruppen übernommen wurden.
Das PERI-R17 kann in folgenden
Betriebsarten eingesetzt werden: Bild 16 zeigt das PERI-R17A1 im Leopard 2A4. Am unteren Rand ist gut der Hebel zu erkennen, mit dem auf den optische Kanal zum EMES umgeschaltet werden kann. Das folgende Bild 17 zeigt den links vor dem Lukenrand untergebrachten, um 360 Grad drehbaren Ausblickkopf des PERI-R17A2. In der 12 Uhr Position kann die Okularscheibe über eine Waschanlage gereinigt werden. Diese Düsen sind rechts unten am Fuss des Ausblickkopfes erkennbar. Zur Steuerung des PERI verfügt der Kommandant rechts an seinem Platz über einen an einem senkrechten Richtgriff angebrachten "Daumendruck"-Schalter. Dieser Richtgriff ist im Bild 18 gut erkennbar. Mit ihm kann auch in schwerem Gelände das PERI sicher geführt werden, da der Griffstock fest steht und der rechten Hand des Kommandanten einen sicheren Halt bietet. Nur durch Verändern des Daumendrucks auf eine cirka 3 cm große gummierte Sensorscheibe kann der Kommandant das Sichtfeld des Periskops in der Höhe und Seite steuern. Am Richtgriff sind die Bedienschalter für die Betriebsstufen angebracht sowie die Abfeuerung der Waffen. Bild 18 zeigt ebenfalls die beim Kommandanten angebrachten
Bedieneinrichtungen der Feuerleitanlage. Das ist zunächst ,
hinter dem weißen Schutzbügel, der
Bedienkasten des PERI mit dem
Hauptschalter, dem Wisch-Wasch-Schalter und den beiden Potentiometern
des Driftabgleichs. Es folgt links der Dimmer der Schalterbeleuchtung
mit Lampentestschalter, es schließt sich an der Kommandantenbedienkasten
für die Nutzung des Wärmebildgerätes und ganz links der Bedienkasten der Nebelmittelwurfanlage,
mit dem geschützten roten Hauptschalter und dem Tastenfeld
für die Auslösung der rechten bzw. linken Wurfbecher. Links
unterhalb folgt der Betriebsstufenschalter der Waffenstabilisierung
mit dem auffälligen weißen Pfeil auf dem Drehschalter. Es können
die Betriebsstufen TURM AUS, BEOBACHTEN und STAB EIN gewählt
werden. Unterhalb des PERI-Fußes, links oben am Bildrand, befindet
sich das Bediengerät für den ballistischen
Rechner, an dem bei der Vorbereitung
des Schießens die einzelnen Werte eingegeben werden und an dem
während des Schießens einzelne Werte manuell korrigiert werden
können. Es besteht weiterhin die Möglichkeit
eine Videokamera für Tagsicht einzubauen, um das Fernsehbild an anderen Bedienplätzen
zur Verfügung zu stellen, wie das schon im Kampfpanzer
Leclerc der Fall ist. Vorgesehen ist die Möglichkeit ein sogenanntes
Tippvisier zu integrieren. Dieses erlaubt nach Antippen eines Winkelspiegels
das Einlaufen der Visierlinie auf die
Blickrichtung dieses Winkelspiegels. Eine Feldjustieranlage vervollständigt
die Feuerleitanlage des Leopard 2. Sie besteht prinzipiell aus den in das
Hauptzielfernrohr und die Waffenstabilisierung integrierten Baugruppen und einem
an der Kanonenmündung angebauten
Referenzspiegel. Wenn nach längerem Feuer
mit der Kanone die
thermische Belastung des Rohres zu groß wird, kann es
|
||||||||||||||||||||||||
|
|

 Die Entwicklung des Nachfolgers für den erfolgreichen Leopard 1
begann bereits Ende der 60er Jahre und lief bis zum Ende der 70er Jahre. Maßgeblichen
Einfluss auf die Entwicklung dieses Kampfpanzers hatten die Ergebnisse der
Entwicklung des Hauptkampfpanzers 70 / MBT-70, die in Zusammenarbeit mit
den USA erfolgte.
Die Entwicklung des Nachfolgers für den erfolgreichen Leopard 1
begann bereits Ende der 60er Jahre und lief bis zum Ende der 70er Jahre. Maßgeblichen
Einfluss auf die Entwicklung dieses Kampfpanzers hatten die Ergebnisse der
Entwicklung des Hauptkampfpanzers 70 / MBT-70, die in Zusammenarbeit mit
den USA erfolgte.