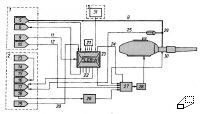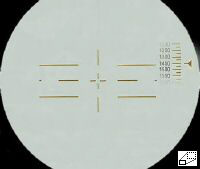|

|
Die Feuerleitanlage des Kampfpanzers Leopard 1A4
 Der
Leopard 1A4 stellt den interessanten Versuch dar, die Ergebnisse
der bisherigen Entwicklungsarbeiten für einen zukünftigen neuen
Kampfpanzer schon in die Modernisierung des Leopard 1einfließen
zu lassen. Aus dem Projekt Kampfpanzer 70 herrührend, führten
die Arbeiten über Experimentalfahrzeuge verlaufend, direkt zum
Leopard 2. Die Entwicklung des 1A4 begann 1971 und schon ab
1974 wurden insgesamt 250 Leopard 1A4 ausgeliefert. Der Turm
entsprach in seiner Form dem Leopard 1A3. Allerdings wurde der
1A4 mit einer umfangreichen und für die damalige Zeit sehr modernen
Feuerleitanlage ausgestattet. Die ausgelieferten 250 Leopard 1A4
wurden jedoch später nicht weiter modernisiert. Sie wurden vom
Leopard 2 ersetzt und vollständig aus dem Truppendienst genommen,
Ein
Teil wurde auf die Version 1A3 zurückgerüstet und an andere
NATO-Staaten verkauft. Die letzte Modernisierung für den Leopard
1 für die Bundewehr erfolgte auf der Basis den Versionen A1A1 bzw. A1A2, erkennbar an der Gummi-Stahl-Zusatzpanzerung am Turm, und
mündete in die Version
1A5. Der
Leopard 1A4 stellt den interessanten Versuch dar, die Ergebnisse
der bisherigen Entwicklungsarbeiten für einen zukünftigen neuen
Kampfpanzer schon in die Modernisierung des Leopard 1einfließen
zu lassen. Aus dem Projekt Kampfpanzer 70 herrührend, führten
die Arbeiten über Experimentalfahrzeuge verlaufend, direkt zum
Leopard 2. Die Entwicklung des 1A4 begann 1971 und schon ab
1974 wurden insgesamt 250 Leopard 1A4 ausgeliefert. Der Turm
entsprach in seiner Form dem Leopard 1A3. Allerdings wurde der
1A4 mit einer umfangreichen und für die damalige Zeit sehr modernen
Feuerleitanlage ausgestattet. Die ausgelieferten 250 Leopard 1A4
wurden jedoch später nicht weiter modernisiert. Sie wurden vom
Leopard 2 ersetzt und vollständig aus dem Truppendienst genommen,
Ein
Teil wurde auf die Version 1A3 zurückgerüstet und an andere
NATO-Staaten verkauft. Die letzte Modernisierung für den Leopard
1 für die Bundewehr erfolgte auf der Basis den Versionen A1A1 bzw. A1A2, erkennbar an der Gummi-Stahl-Zusatzpanzerung am Turm, und
mündete in die Version
1A5.
Der Leopard 1A4 ist ausgestattet mit
einer umfangreichen, automatischen Feuerleitanlage. Die Hauptbaugruppen
sind der Raumbildentfernungsmesser EMES-12, der auch als Hauptzielfernrohr
 diente,
der analoge, ballistische Rechner FLER-H, das Komandantenrundblickperiskop
PERI-R12 und das Hilfszielfernrohr TZF-1A. diente,
der analoge, ballistische Rechner FLER-H, das Komandantenrundblickperiskop
PERI-R12 und das Hilfszielfernrohr TZF-1A.
Der Kommandant
erhielt mit dem PERI-R12 der Firma Zeiss-Anschütz ein völlig
neues Beobachtungsgerät. Mit ihm konnte er unabhängig vom  Richtschützen
auch in der Bewegung Ziele aufklären und beobachten. Das Sichtfeld
des PERI-R12 besaß eine Stabilisierung des Sichtfeldes, bei
einer 2 oder wahlweise 8facher Vergrößerung. Der Richtbereich
in der Vertikalen beträgt -13 Grad bis +20 Grad. und 360 Grad
in der Horizontalen. Ein passives Nachtsichtgerät der zweiten
Generation war in das PERI-R12 integriert. Der Einblick in das
PERI-R12 ist monokular, das bedeutet, ein Okular ist für den
Tag- und das andere Okular für den Nachtbetrieb. Die Betriebsarten
des PERI-R12 sind: Richtschützen
auch in der Bewegung Ziele aufklären und beobachten. Das Sichtfeld
des PERI-R12 besaß eine Stabilisierung des Sichtfeldes, bei
einer 2 oder wahlweise 8facher Vergrößerung. Der Richtbereich
in der Vertikalen beträgt -13 Grad bis +20 Grad. und 360 Grad
in der Horizontalen. Ein passives Nachtsichtgerät der zweiten
Generation war in das PERI-R12 integriert. Der Einblick in das
PERI-R12 ist monokular, das bedeutet, ein Okular ist für den
Tag- und das andere Okular für den Nachtbetrieb. Die Betriebsarten
des PERI-R12 sind:
- KP,
der Kommandant führt das PERI und beobachtet unabhängig vom
Richtschützen
- ZÜ
, der Kommandant überwacht den Richtschützen.
- KHP ,
der Kommandant führt die Hauptwaffe über das PERI
Um erkannte
Ziele rasch an den Richtschützen übergeben zu können, war es
möglich die Visierline des EMES-12 auf die Visierline des PERI
einschwenken zulassen. Zusätzlich konnte der Kommandant das
PERI auf zwei Index-Positionen einlaufen lassen, in die 12-
und 6-Uhr-Position in Bezug zum Turm. Beim Überwachen des Richtschützen
lief die Visierlinie auf die Visierlinie des EMES-12 ein und
folgte den Richtbewegungen von Turm und Kanone. Beim Betätigen
der Übersteuerungstaste am Richtgriff konnte der Kommandant
die Führung der Bewaffnung vollständig übernehmen. Die Entfernungsangaben
aus dem EMES-12 wurden am Platz des Kommandanten angezeigt und
die Richtmarke im PERI entsprechend angepasst. In den Bildern
unten wird der Arbeitsplatz des Kommandanten gezeigt. Ganz links
das PERI und die Winkelspiegel, die, wie im Leopard üblich,
eine 360-Grad Rundumsicht gewährleisten. Das mittlere Bild zeigt
den Richtgriff mit den Tastern für die Betriebsstufen des PERI
und der Abfeuerung. Der schwarze Kasten links oben im Bild ist
die Anzeigeeinheit für die vom Richtschützen gemessene Entfernung.
Direkt darunter befindet sich, am Turmdrehkranz befestigt, der
Hydraulikmotor mit dem Getriebe des Tumrschwenkwerkes. Die gummierte
Armauflage soll dem Kommandanten ein ruhiges Richten auch während
der Fahrt ermöglichen. Der Richtgriff fand sich übrigens noch
in den Prototypen des Leopard 2 wieder, machte dann aber dem
Daumendrucksensor Platz, der ergonomisch zumindest umstritten
ist.



Das obere rechte Bild zeigt
die wichtigsten Bedienelemente des Kommandanten. Das Leucht-Schalterfeld
links enthält die Taster für die Waffenstabilisierung, wie STAB
EIN - STAB BEREIT und HYDRAULIK, sowie die Anzeigen für die Betriebstufen
des PERI und die Auswahl der Abfeuerung für Kanone HW oder MG.
Es folgt rechts oberhalb der Schaltkasten für die Steuerung
des Schieß-Scheinwerfers. Der Drehschalter mit dem weißen Pfeil
schaltet von AUS über ANLAGE EIN zu Infrarotlicht IR oder WEISS
LICHT. Unter dem Drehschalter befindet sich ein weiter Kippschalter
mit dem vom engen Lichtstrahl auf breit gestreutes Licht umgeschaltet
werden konnte. Unter dem Scheinwerfer-Schaltkasten befindet
sich die mit einer Klappe verschlossene Justierung des PERI
und die Potentiometer für den Driftabgleich in Höhe und Seite
sowie der Schalter SICHER und der Hauptschalter für das PERI. Rechts
oben folgt der große Drehknopf für die Helligkeitseinstellung
der Anzeigeleuchten und ein Lampentest-Schalter. Darunter befindet
sich der rote Taster für den Notaus der Waffenrichtanlage. Ganz
rechts befindet sich schließlich das Bedienfeld der Nebelmittelwurfanlage.
Ganz unten, direkt über dem Turmdrehkranz befindet sich das
Rechnerbediengerät RPP für die Prüfung der korrekten Arbeit
des ballistischen Rechners. An der äußersten rechten Seite befindet
sich abschließend ein Spannungsmessgerät für die Überwachung
der Bordspannung.
 Dem
Richtschützen steht das EMES-12A1 der Firma Zeiss als
Zielfernrohr und Entfernungsmesser zur Verfügung. Es handelt
sich um einen Raumbildentfernungsmesser. Die Option der Entfernungsmessung
über das Schnittbildverfahren, wie es noch beim TEM-2
der bisherigen Leopard 1 möglich war, stand nicht mehr zur Verfügung.
Über einen mechanischen Vergrößerungswechsler konnte zwischen
einer 8-fachen und einer 16-fachen Vergrößerung umgeschaltet werden.
Zusätzlich konnten ein Laser-Schutzfilter und Licht-Schutzfilter
zugeschaltet werden. Das Strichbild des EMES-12 wurde vom analogen
Feuerleit-Einheits-Rechner FLER-H gesteuert. Dabei wurde die
Entfernung, die Munitionsart und verschiedene ballistische und
meteorologische Angaben berücksichtigt. Die Vorhalte wurde durch
Geber der horizontalen Richtgeschwindigkeit beim Begleiten beweglicher
Ziele ermittelt. Die Ausblicköffnungen des EMES-12 sind außen
durch gepanzerte Blenden verschlossen und können durch eine
Kurbel an der Turmdecke beim Richtschützen geöffnet werden.
Links von den beiden Okularen des EMES-12 befindet sich das
Okular des TZF-1A,
das als Hilfzielfernrohr für den Notbetrieb zu Verfügung steht. Dem
Richtschützen steht das EMES-12A1 der Firma Zeiss als
Zielfernrohr und Entfernungsmesser zur Verfügung. Es handelt
sich um einen Raumbildentfernungsmesser. Die Option der Entfernungsmessung
über das Schnittbildverfahren, wie es noch beim TEM-2
der bisherigen Leopard 1 möglich war, stand nicht mehr zur Verfügung.
Über einen mechanischen Vergrößerungswechsler konnte zwischen
einer 8-fachen und einer 16-fachen Vergrößerung umgeschaltet werden.
Zusätzlich konnten ein Laser-Schutzfilter und Licht-Schutzfilter
zugeschaltet werden. Das Strichbild des EMES-12 wurde vom analogen
Feuerleit-Einheits-Rechner FLER-H gesteuert. Dabei wurde die
Entfernung, die Munitionsart und verschiedene ballistische und
meteorologische Angaben berücksichtigt. Die Vorhalte wurde durch
Geber der horizontalen Richtgeschwindigkeit beim Begleiten beweglicher
Ziele ermittelt. Die Ausblicköffnungen des EMES-12 sind außen
durch gepanzerte Blenden verschlossen und können durch eine
Kurbel an der Turmdecke beim Richtschützen geöffnet werden.
Links von den beiden Okularen des EMES-12 befindet sich das
Okular des TZF-1A,
das als Hilfzielfernrohr für den Notbetrieb zu Verfügung steht.
D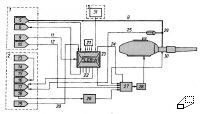 as
Blockschaltbild zeigt prinzipiell den Aufbau des Feuerleitrechners
FLER-H. Bedieneinheit 1 gehört
zum Richtschützen und umfasst den Entfernungsmesser 5,
den Antrieb der Visiereinstellung 6, das Rechnerbediengerät
9 und die Richtgriffe 10, deren Signale 12
an die Waffenstabilisierung gehen. Die Bedieneinheit 2
beim Kommandanten umfasst den Richtgriff 13, die
Winkelübertragungseinheit PERI-EMES 14, die Tag/Nacht-Umschaltung
15, die Steuereinheit für die Betriebsstufen des PERI,
also KP 16
, KHP
17, sowie ZÜ
18, das Rechnersteuergerät Kommandant 19. Die
Bedieneinheit 3 bildet das Ladeschützenbediengerät
31 für die Munitionseingabe. Der eigentliche Rechner
23 ist verbunden mit Gebern 21 und den Reserveausgängen
22. Das elektronische Richtsystem 26 verbindet die
Waffenstabilisierung 27, die Richtantriebe 28,
den vertikalen Lagegeber der Kanone 29 und die Kreiseleinheit
30 mit dem Feuerleitrechner. Die gemessene Entfernung
8 + 7 geht direkt über das EMES in den Rechner ein, das
PERI ist über die Synchronisationskette 25 eingebunden.
Die Anfangsangaben für Systemfehler und Schusstafelwerte 11
werden ebenfalls in den Rechner eingespeist. as
Blockschaltbild zeigt prinzipiell den Aufbau des Feuerleitrechners
FLER-H. Bedieneinheit 1 gehört
zum Richtschützen und umfasst den Entfernungsmesser 5,
den Antrieb der Visiereinstellung 6, das Rechnerbediengerät
9 und die Richtgriffe 10, deren Signale 12
an die Waffenstabilisierung gehen. Die Bedieneinheit 2
beim Kommandanten umfasst den Richtgriff 13, die
Winkelübertragungseinheit PERI-EMES 14, die Tag/Nacht-Umschaltung
15, die Steuereinheit für die Betriebsstufen des PERI,
also KP 16
, KHP
17, sowie ZÜ
18, das Rechnersteuergerät Kommandant 19. Die
Bedieneinheit 3 bildet das Ladeschützenbediengerät
31 für die Munitionseingabe. Der eigentliche Rechner
23 ist verbunden mit Gebern 21 und den Reserveausgängen
22. Das elektronische Richtsystem 26 verbindet die
Waffenstabilisierung 27, die Richtantriebe 28,
den vertikalen Lagegeber der Kanone 29 und die Kreiseleinheit
30 mit dem Feuerleitrechner. Die gemessene Entfernung
8 + 7 geht direkt über das EMES in den Rechner ein, das
PERI ist über die Synchronisationskette 25 eingebunden.
Die Anfangsangaben für Systemfehler und Schusstafelwerte 11
werden ebenfalls in den Rechner eingespeist.
  Das
Bild links zeigt die Richtgriffe des Richtschützen, die Handkurbel
der hydraulischen Höhenrichteinrichtung und rechts von den Richtgriffen
die Kurbel für das manuelle Schwenken des Turms. Das Schalterfeld
rechts unten beim Okular des Hilfszielfernrohres TZF-1A umfasst
die Leucht-Taster für HYDRAULIK, STAB EIN, die Anzeige für die
aktuelle Betriebstufe des PERI und die Umschaltung der Abfeuerung
Kanone und des MG mit einem Kippschalter an der unteren Seite
des Schaltkastens. Außerdem enthält es einen Taster zum Umschalten
des Rechners auf E-1000 mit dem im Notfall sofort auf den Gefechtsaufsatz
1000 geschaltet werden kann. In diesem Fall können Ziele im
Entfernungsbereich von 0 bis etwa 1500 m, bei Haltepunkt Zielmitte,
ohne Entfernungsberücksichtigung bekämpft werden. Das rechte
Bild zeigt den Turmstellungsanzeiger und den Schaltkasten für
die Waffenstabilisierung. Die Schaltstufen sind TURM AUS, BEOBACHTEN,
STAB BEREIT und STAB EIN. Links von diese Schaltkasten
ein Schaltfeld mit Potentiometern für die Regelung der Helligkeit
der Anzeigeleuchten und ein Lampenkontrollschalter. Oberhalb
des Schaltkastens befindet sich der Getriebeumschalter des manuellen
Turmschwenkwerkes. Mit dem Umschalter kann die Richtgeschwindigkeit
beim Handrichten von Fein auf Grob bzw schnelleres Richten bei
erhöhtem Kraftaufwand umgeschaltet werden. Das
Bild links zeigt die Richtgriffe des Richtschützen, die Handkurbel
der hydraulischen Höhenrichteinrichtung und rechts von den Richtgriffen
die Kurbel für das manuelle Schwenken des Turms. Das Schalterfeld
rechts unten beim Okular des Hilfszielfernrohres TZF-1A umfasst
die Leucht-Taster für HYDRAULIK, STAB EIN, die Anzeige für die
aktuelle Betriebstufe des PERI und die Umschaltung der Abfeuerung
Kanone und des MG mit einem Kippschalter an der unteren Seite
des Schaltkastens. Außerdem enthält es einen Taster zum Umschalten
des Rechners auf E-1000 mit dem im Notfall sofort auf den Gefechtsaufsatz
1000 geschaltet werden kann. In diesem Fall können Ziele im
Entfernungsbereich von 0 bis etwa 1500 m, bei Haltepunkt Zielmitte,
ohne Entfernungsberücksichtigung bekämpft werden. Das rechte
Bild zeigt den Turmstellungsanzeiger und den Schaltkasten für
die Waffenstabilisierung. Die Schaltstufen sind TURM AUS, BEOBACHTEN,
STAB BEREIT und STAB EIN. Links von diese Schaltkasten
ein Schaltfeld mit Potentiometern für die Regelung der Helligkeit
der Anzeigeleuchten und ein Lampenkontrollschalter. Oberhalb
des Schaltkastens befindet sich der Getriebeumschalter des manuellen
Turmschwenkwerkes. Mit dem Umschalter kann die Richtgeschwindigkeit
beim Handrichten von Fein auf Grob bzw schnelleres Richten bei
erhöhtem Kraftaufwand umgeschaltet werden.
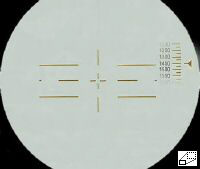 Dieses
Bild zeigt das Strichbild des EMES-12 das durch einen in der
Helligkeit regelbaren Visiermarkenprojektor eingeblendet wird.
Rechts befindet sich die Entfernungsskala des Entfernungsmeßsystems.
Beim Messen der Entfernung muss bei diesem stereoskopischen
System eine Messmarke im räumlich erscheinenden Blickfeld scheinbar
über das Ziel gestellt werden. Dies erfordert die Fähigkeit zum
räumlichen Sehen beim Schützen. Zum Messen konnte das Richtkreuz
ausgeblendet werden, es war lediglich ein senkrechte Messmarke
zu sehen. Oft wurde aber von geübten Richtschützen mit vollständig
angezeigtem Strichbild gemessen um die notwendige Verzögerung
beim Umschalten des Strichbildes zu vermeiden und die Zeit zur
Feuereröffnung um einige Sekunden zu verkürzen. Der Messvorgang
wurde durch eine Wippe gesteuert, die sich als Fuß-Schalter
auf dem Boden des Turmkorbes befand. Ein präzises Messen der
Entfernung während der Fahrt war allerdings nicht möglich. Dieses
Bild zeigt das Strichbild des EMES-12 das durch einen in der
Helligkeit regelbaren Visiermarkenprojektor eingeblendet wird.
Rechts befindet sich die Entfernungsskala des Entfernungsmeßsystems.
Beim Messen der Entfernung muss bei diesem stereoskopischen
System eine Messmarke im räumlich erscheinenden Blickfeld scheinbar
über das Ziel gestellt werden. Dies erfordert die Fähigkeit zum
räumlichen Sehen beim Schützen. Zum Messen konnte das Richtkreuz
ausgeblendet werden, es war lediglich ein senkrechte Messmarke
zu sehen. Oft wurde aber von geübten Richtschützen mit vollständig
angezeigtem Strichbild gemessen um die notwendige Verzögerung
beim Umschalten des Strichbildes zu vermeiden und die Zeit zur
Feuereröffnung um einige Sekunden zu verkürzen. Der Messvorgang
wurde durch eine Wippe gesteuert, die sich als Fuß-Schalter
auf dem Boden des Turmkorbes befand. Ein präzises Messen der
Entfernung während der Fahrt war allerdings nicht möglich.
  Das
Bild links, aus Sicht des Ladeschützen, zeigt das Ladeschützenbediengerät.
An ihm schaltet der Ladeschütze die von ihm geladenen Munition,
das kann APDS, HEAT oder HEP sein, und betätigt den grünen Leucht-Taster
BEREIT. Nach dem Abfeuern geht das Pult automatisch in den Zustand
SICHER über, was an dem roten Leuchtfeld angezeigt wird. Am
Ladeschützenbedienpult links befindet sich ebenfalls der Sicherheits-/Hauptschalter
der hydraulischen Richtanlage und ein Schalter für das Punktjustieren
der Waffenanlage, was an der Richthydraulik eine Umschaltung
erforderlich macht. Im Turmheck, das rechte Bild, befindet sich
ein Teil der Elektronikbaugruppen der Rechneranlage, der PERI-Steuerung
und der Waffenstabilisierung. Außerdem der Funkgerätesatz, Halterungen
für Ersatzwinkelspiegel, Nebelwurfkörper und weiteres Zubehör Das
Bild links, aus Sicht des Ladeschützen, zeigt das Ladeschützenbediengerät.
An ihm schaltet der Ladeschütze die von ihm geladenen Munition,
das kann APDS, HEAT oder HEP sein, und betätigt den grünen Leucht-Taster
BEREIT. Nach dem Abfeuern geht das Pult automatisch in den Zustand
SICHER über, was an dem roten Leuchtfeld angezeigt wird. Am
Ladeschützenbedienpult links befindet sich ebenfalls der Sicherheits-/Hauptschalter
der hydraulischen Richtanlage und ein Schalter für das Punktjustieren
der Waffenanlage, was an der Richthydraulik eine Umschaltung
erforderlich macht. Im Turmheck, das rechte Bild, befindet sich
ein Teil der Elektronikbaugruppen der Rechneranlage, der PERI-Steuerung
und der Waffenstabilisierung. Außerdem der Funkgerätesatz, Halterungen
für Ersatzwinkelspiegel, Nebelwurfkörper und weiteres Zubehör
Die
Feuerleitanlage des Leopard 1A4 findet sich, modifiziert, in
verschiedenen Prototypen des Leopard 2 bis zum Prototyp Nummer
17 wieder. Erst dann wurde sie im Leopard 2AV vom EMES-15
abgelöst. Die praktischen Erfahrungen aus dem Betrieb dieser
Feuerleitanlage waren zweifellos unverzichtbar für die Entwicklung
des Leopard 2.
|

 Der
Leopard 1A4 stellt den interessanten Versuch dar, die Ergebnisse
der bisherigen Entwicklungsarbeiten für einen zukünftigen neuen
Kampfpanzer schon in die Modernisierung des Leopard 1einfließen
zu lassen. Aus dem Projekt Kampfpanzer 70 herrührend, führten
die Arbeiten über Experimentalfahrzeuge verlaufend, direkt zum
Leopard 2. Die Entwicklung des 1A4 begann 1971 und schon ab
1974 wurden insgesamt 250 Leopard 1A4 ausgeliefert. Der Turm
entsprach in seiner Form dem Leopard 1A3. Allerdings wurde der
1A4 mit einer umfangreichen und für die damalige Zeit sehr modernen
Feuerleitanlage ausgestattet. Die ausgelieferten 250 Leopard 1A4
wurden jedoch später nicht weiter modernisiert. Sie wurden vom
Leopard 2 ersetzt und vollständig aus dem Truppendienst genommen,
Ein
Teil wurde auf die Version 1A3 zurückgerüstet und an andere
NATO-Staaten verkauft. Die letzte Modernisierung für den Leopard
1 für die Bundewehr erfolgte auf der Basis den Versionen A1A1 bzw. A1A2, erkennbar an der Gummi-Stahl-Zusatzpanzerung am Turm, und
mündete in die
Der
Leopard 1A4 stellt den interessanten Versuch dar, die Ergebnisse
der bisherigen Entwicklungsarbeiten für einen zukünftigen neuen
Kampfpanzer schon in die Modernisierung des Leopard 1einfließen
zu lassen. Aus dem Projekt Kampfpanzer 70 herrührend, führten
die Arbeiten über Experimentalfahrzeuge verlaufend, direkt zum
Leopard 2. Die Entwicklung des 1A4 begann 1971 und schon ab
1974 wurden insgesamt 250 Leopard 1A4 ausgeliefert. Der Turm
entsprach in seiner Form dem Leopard 1A3. Allerdings wurde der
1A4 mit einer umfangreichen und für die damalige Zeit sehr modernen
Feuerleitanlage ausgestattet. Die ausgelieferten 250 Leopard 1A4
wurden jedoch später nicht weiter modernisiert. Sie wurden vom
Leopard 2 ersetzt und vollständig aus dem Truppendienst genommen,
Ein
Teil wurde auf die Version 1A3 zurückgerüstet und an andere
NATO-Staaten verkauft. Die letzte Modernisierung für den Leopard
1 für die Bundewehr erfolgte auf der Basis den Versionen A1A1 bzw. A1A2, erkennbar an der Gummi-Stahl-Zusatzpanzerung am Turm, und
mündete in die 
 Richtschützen
auch in der Bewegung Ziele aufklären und beobachten. Das Sichtfeld
des PERI-R12 besaß eine Stabilisierung des Sichtfeldes, bei
einer 2 oder wahlweise 8facher Vergrößerung. Der Richtbereich
in der Vertikalen beträgt -13 Grad bis +20 Grad. und 360 Grad
in der Horizontalen. Ein passives Nachtsichtgerät der zweiten
Generation war in das PERI-R12 integriert. Der Einblick in das
PERI-R12 ist monokular, das bedeutet, ein Okular ist für den
Tag- und das andere Okular für den Nachtbetrieb. Die Betriebsarten
des PERI-R12 sind:
Richtschützen
auch in der Bewegung Ziele aufklären und beobachten. Das Sichtfeld
des PERI-R12 besaß eine Stabilisierung des Sichtfeldes, bei
einer 2 oder wahlweise 8facher Vergrößerung. Der Richtbereich
in der Vertikalen beträgt -13 Grad bis +20 Grad. und 360 Grad
in der Horizontalen. Ein passives Nachtsichtgerät der zweiten
Generation war in das PERI-R12 integriert. Der Einblick in das
PERI-R12 ist monokular, das bedeutet, ein Okular ist für den
Tag- und das andere Okular für den Nachtbetrieb. Die Betriebsarten
des PERI-R12 sind: