|

|
Der Feuerleitanlage
des Panzer 68
 In
den 50er Jahren waren die Schweizer Panzertuppen zunächst mit französischen
AMX-13 und britischen Centurion ausgerüstet worden. Es zeigte sich
jedoch rasch, dass diese Kampfpanzer nur ungenügend an die spezifischen
Geländebedingungen der Schweiz angepasst waren. Man entschloss
sich deshalb einen eigenen Kampfpanzer zu entwickeln. 1957 wurden
10 Fahrzeuge eines Entwicklungsmusters für Versuchszwecke bestellt,
die unter der Typenbezeichnung Panzer 58 übernommen wurden.
Nach vielen Tests und Überarbeitungen wurde der Kampfpanzer
im Jahre 1961 unter der Bezeichnung Panzer 61 in die Bewaffnung
der Schweizer Streitkräfte übernommen. Die Entwickler hatten
einen Kampfpanzer konstruiert, der mit den in dieser Zeit verfügbaren
Mustern auf vergleichbarem Niveau lag. Insbesondere das
Basisfahrzeug präsentierte sich mit einigen sehr fortschrittlichen
Lösungen. Im Verlaufe seiner erfolgreichen über 25jährigen
Nutzung wurde der Panzer 61 mehrmals modernisiert. Die
Erfahrungen mit dem Panzer 61 mündeten schließlich in eine umfassende
Neuentwicklung, den Panzer 68. Im Jahre 1975 erhielt der Panzer 68 einen neuen größeren
Turm und im Jahre 1988 eine automatische Feuerleitanlage mit
einem hochmodernen Hauptzielfernrohr mit Laser-Entfernungsmesser.
Diese letzte Version ist bekannt geworden unter der Bezeichung Panzer 68/88. In
den 50er Jahren waren die Schweizer Panzertuppen zunächst mit französischen
AMX-13 und britischen Centurion ausgerüstet worden. Es zeigte sich
jedoch rasch, dass diese Kampfpanzer nur ungenügend an die spezifischen
Geländebedingungen der Schweiz angepasst waren. Man entschloss
sich deshalb einen eigenen Kampfpanzer zu entwickeln. 1957 wurden
10 Fahrzeuge eines Entwicklungsmusters für Versuchszwecke bestellt,
die unter der Typenbezeichnung Panzer 58 übernommen wurden.
Nach vielen Tests und Überarbeitungen wurde der Kampfpanzer
im Jahre 1961 unter der Bezeichnung Panzer 61 in die Bewaffnung
der Schweizer Streitkräfte übernommen. Die Entwickler hatten
einen Kampfpanzer konstruiert, der mit den in dieser Zeit verfügbaren
Mustern auf vergleichbarem Niveau lag. Insbesondere das
Basisfahrzeug präsentierte sich mit einigen sehr fortschrittlichen
Lösungen. Im Verlaufe seiner erfolgreichen über 25jährigen
Nutzung wurde der Panzer 61 mehrmals modernisiert. Die
Erfahrungen mit dem Panzer 61 mündeten schließlich in eine umfassende
Neuentwicklung, den Panzer 68. Im Jahre 1975 erhielt der Panzer 68 einen neuen größeren
Turm und im Jahre 1988 eine automatische Feuerleitanlage mit
einem hochmodernen Hauptzielfernrohr mit Laser-Entfernungsmesser.
Diese letzte Version ist bekannt geworden unter der Bezeichung Panzer 68/88.
Im Folgenden wird ein Überblick über die Feuerleitanlage
des Panzer 68 gegeben, wie sie dem Rüststand Anfang der 80er
Jahre entsprach. Zu späteren Baulosen und Modernisierungen des
Panzer 68 kann es Abweichungen geben.
Der Kommandant des Pz 68
erhielt eine feststehende Kuppel
mit 8 großen Winkelspiegeln zur Rundumbeobachtung. Für das geschützte
Beobachten aus der geöffneten Luke kann die Luke in drei Positonen
arretiert  werden.
Möglicherweise aus Kostengründen verzichteten die Entwickler auf ein vergrößerndes
Beobachtungsgerät in einer um 360° drehbaren Kuppel, wie es
zuvor den Kommandanten der Panzer 55, so die
Schweizer Bezeichnung des britischen Kampfpanzers Centurion,
zur Verfügung gestanden hatte. werden.
Möglicherweise aus Kostengründen verzichteten die Entwickler auf ein vergrößerndes
Beobachtungsgerät in einer um 360° drehbaren Kuppel, wie es
zuvor den Kommandanten der Panzer 55, so die
Schweizer Bezeichnung des britischen Kampfpanzers Centurion,
zur Verfügung gestanden hatte.
Analog des französischen AMX-30 hat
der Kommandant die Aufgabe, den Entfernungsmesser, der sich
hinter dem Richtschützen befindet, zu bedienen. Der Entfernungsmesser,
eine Entwicklung der Schweizer Firma Wild, besitzt eine Messbasis
vom 1550 mm und einen Messbereich von 400 ... 4000
m, bei einer 8-fachen Vergrößerung. Es handelt sich um einen
Schnittbildentfernungsmesser mit Messfenster. Diese monokulare
Gerät erfüllte
gleichzeitig die Funktion eines doublierenden Zielfernrohres.
Das linke Bild zeigt die Bedienelemente des sogenannten Telemeters.
Das rechte der beiden Okulare ist das Okular des Zielfernrohrteils
mit dem Entfernungsmessfenster, das linke Okular ermöglicht
die Sicht auf die Entfernungsanzeige. Unterhalb der Okulare
an der Unterseite des Gehäuses befindet sich der Drehknopf für
die Entfernungsermittlung. Links der beiden
Okulare  befindet
sich die Entfernungseinstelleinrichtung, mit deren Hilfe die
zuvor ermittelte Entfernung manuell einzustellen ist. Beim Einstellen
der Entfernung durch den Kommandanten wird gleichlaufend auch
die Entfernung im Richtschützenzielfernrohr eingestellt. Die Entfernungstrommel,
der Drehknopf für die Einstellung der Schussentfernung, ragt
unterhalb der Entfernungseinstelleinrichtung nach schräg rechts
heraus.
In dem rötlich erscheinenden Sichtfenster der Entfernungseinstelleinrichtung,
oberhalb des vorstehenden Zapfens, sind die verschiedenen Skalen
entsprechend der verwendeten Munitionsarten enthalten. Zur besseren
Unterscheidung sind die Skalen unterschiedlich gefärbt. Die
einstellbaren Schussentfernungen betragen für das APDS-Geschosse
(rote Skala) bis 3000 m, für die Spreng-Granate und die Brand-Nebel-Granate
bis 5000 m (grüne Skale) und für die Panzer-Spreng-Granate (HESH)
(orange Skale) bis 4500 m. Mit dem 7,5 mm Turm-MG (rote Skala)
kann bis 1500 m geschossen werden. Mit Hilfe des Drehknopfes
an der rechten unteren Seite der Entfernungstrommel können Tages-Korrekturen
für den Erhöhungswinkel eingestellt werden. Das ermöglicht die
Berücksichtigung von Bedingungen, die von den schusstafelmäßigen
Werten abweichen oder die Korrektur nicht befindet
sich die Entfernungseinstelleinrichtung, mit deren Hilfe die
zuvor ermittelte Entfernung manuell einzustellen ist. Beim Einstellen
der Entfernung durch den Kommandanten wird gleichlaufend auch
die Entfernung im Richtschützenzielfernrohr eingestellt. Die Entfernungstrommel,
der Drehknopf für die Einstellung der Schussentfernung, ragt
unterhalb der Entfernungseinstelleinrichtung nach schräg rechts
heraus.
In dem rötlich erscheinenden Sichtfenster der Entfernungseinstelleinrichtung,
oberhalb des vorstehenden Zapfens, sind die verschiedenen Skalen
entsprechend der verwendeten Munitionsarten enthalten. Zur besseren
Unterscheidung sind die Skalen unterschiedlich gefärbt. Die
einstellbaren Schussentfernungen betragen für das APDS-Geschosse
(rote Skala) bis 3000 m, für die Spreng-Granate und die Brand-Nebel-Granate
bis 5000 m (grüne Skale) und für die Panzer-Spreng-Granate (HESH)
(orange Skale) bis 4500 m. Mit dem 7,5 mm Turm-MG (rote Skala)
kann bis 1500 m geschossen werden. Mit Hilfe des Drehknopfes
an der rechten unteren Seite der Entfernungstrommel können Tages-Korrekturen
für den Erhöhungswinkel eingestellt werden. Das ermöglicht die
Berücksichtigung von Bedingungen, die von den schusstafelmäßigen
Werten abweichen oder die Korrektur nicht 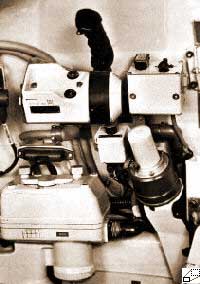 normaler
Trefferlagen. Das Farbfoto zeigt einen Blick durch das Telemeter
des Kommandanten. Das Strichbild mit dem zentralen Doppelfadenkreuz
und waagerechten Hilfsstrichen von 25 Strich nach beiden Seiten,
entspricht dem des Richtschützenzielfernrohres. Zusätzlich erscheint
im Sichtfeld das Messfenster. Dabei schneidet sich das Teilbild
des Entfernungsmessers mit dem Hauptsichtfeld. Durch das Angleichen
der beiden Teilbilder wird die korrekte Entfernung eingestellt.
Alle Skalen sind elektrisch beleuchtet und dimmbar. Mit Hilfe
des Entfernungsmessers kann der Kommandant, wie schon ausgeführt,
selbständig das Feuer führen. Dazu bietet die elektrohydraulische
Richtanlage dem Kommandanten die Möglichkeit, die Turmsteuerung
vollständig zu übernehmen. Das linke Bild zeigt den
Richtgriff des Kommandanten. Beim Umfassen des Richtgriffes
wird ein Tastschalter betätigt, der die Funktion der Richtanlage
vom Richtschützen auf den Kommandanten umschaltet. Mit einem
Tastschalter am Richtgriff wird die jeweils eingeschaltete Waffe, Kanone oder Turm-MG, abgefeuert. Bei einem möglichen Versagen
der elektrischen Abfeuerung kann die Kanone mit einem Stoßgenerator
abgefeuert werden. Der Stoßgenerator, rechts unterhalb des Richtgriffes,
ist mit einer weißen Schutzkappe gegen versehentliches Betätigen
geschützt. Direkt unterhalb des Richtgriffes befindet sich ein
Prüfschaltkasten der Richtanlage. Schließlich befindet sich
links unterhalb des Richtgriffes die sogenannte Seitenrichtuhr
für das Schießen bei Nacht oder im indirekten Richten nach zuvor
ermittelten Werten. normaler
Trefferlagen. Das Farbfoto zeigt einen Blick durch das Telemeter
des Kommandanten. Das Strichbild mit dem zentralen Doppelfadenkreuz
und waagerechten Hilfsstrichen von 25 Strich nach beiden Seiten,
entspricht dem des Richtschützenzielfernrohres. Zusätzlich erscheint
im Sichtfeld das Messfenster. Dabei schneidet sich das Teilbild
des Entfernungsmessers mit dem Hauptsichtfeld. Durch das Angleichen
der beiden Teilbilder wird die korrekte Entfernung eingestellt.
Alle Skalen sind elektrisch beleuchtet und dimmbar. Mit Hilfe
des Entfernungsmessers kann der Kommandant, wie schon ausgeführt,
selbständig das Feuer führen. Dazu bietet die elektrohydraulische
Richtanlage dem Kommandanten die Möglichkeit, die Turmsteuerung
vollständig zu übernehmen. Das linke Bild zeigt den
Richtgriff des Kommandanten. Beim Umfassen des Richtgriffes
wird ein Tastschalter betätigt, der die Funktion der Richtanlage
vom Richtschützen auf den Kommandanten umschaltet. Mit einem
Tastschalter am Richtgriff wird die jeweils eingeschaltete Waffe, Kanone oder Turm-MG, abgefeuert. Bei einem möglichen Versagen
der elektrischen Abfeuerung kann die Kanone mit einem Stoßgenerator
abgefeuert werden. Der Stoßgenerator, rechts unterhalb des Richtgriffes,
ist mit einer weißen Schutzkappe gegen versehentliches Betätigen
geschützt. Direkt unterhalb des Richtgriffes befindet sich ein
Prüfschaltkasten der Richtanlage. Schließlich befindet sich
links unterhalb des Richtgriffes die sogenannte Seitenrichtuhr
für das Schießen bei Nacht oder im indirekten Richten nach zuvor
ermittelten Werten.
  
Der
Richtschütze verfügt über ein periskopisches Zielfernrohr
mit wahlweise 8-facher oder 2,7-facher Vergrößerung. Im Sichtfeld
des ebenfalls von der Schweizer Firma Wild entwickelten Zielfernrohres
ist das gleiche Strichbild wie im Entfernungsmesser dargestellt,
es fehlt lediglich das Messfenster. Das linke Bild zeigt den Arbeitsplatz
des Richtschützen. Das rechte Okular gehört zum Zielfernrohr.
Mit dem rechts angebrachten Drehknopf werden Korrekturen der
tagesaktuellen Werte in der Seite und mit dem unten herausragenden
Drehknopf der tagesaktuellen Werte in der Höhe eingestellt.
Der weiße, nach unten rechts ragende Zylinder beinhaltet die
elektrische Feuerblende. Im Moment des Abfeuerns wird kurzzeitig
eine elektromechanische Blende im Sichtfeld des Zielfernrohres geschlossen um eine
Blendung des Richtschützen, insbesondere bei Nacht, durch das
Mündungsfeuer der Kanone zu verhindern. Hinter der Betätigung
der Feuerblende befindet sich der Vergrößerungsumstellhebel.
Mit Hilfe des großen Rasthebels rechts hinter dem Zielfernrohr
wird die gepanzerte Schutzblende vor dem Objektiv an der Turmoberseite
geöffnet. Interessanterweise besitzt dieses Zielfernrohr keine
Entfernungsskala im Sichtfeld des Okulars. Zum Ablesen und Einstellen
der vom Kommandanten ermittelten oder geschätzten Entfernung
blickt der Richtschütze mit dem linken Auge in das Okular der
Entfernungseinstelleinrichtung. Diese Entfernungseinstelleinrichtung
ist links des Zielfernrohres erkennbar. Von oben links ragt
das weiße, kastenförmige Mittelteil
der Entfernungseinstelleinrichtung in das Bild hinein. Es folgt
ein zylindrisches Teil, an dessen Ende sich ein weißer quadratischer
Kasten befindet. Das zylindrische Teil ist der gerändelte Drehgriff
der Entfernungseinstellung des Richtschützen. In dem weißen
Abschlußkasten befindet sich die Skaleneinrichtung, analog wie
beim Entfernungsmesser beschrieben. Mit dem linken Okular wird
direkt auf diese Entfernungsskale geblickt. Um ein ungewolltes
Verdrehen der Entfernungseinstellung zu vermeiden, muss der
Richtschütze vor dem Einstellen den Drehgriff nach vorne drücken.
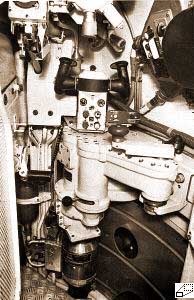 Das linke Bild
zeigt abschließend noch einen Blick auf die Richteinrichtungen
des Schützen. Rechts am Turmdrehkranz befindet sich der elektrohydraulische
Seitenrichtantrieb. An dessen rechter Oberseite befindet sich
die Handrichtkurbel. An der linken Seite ragt der Kugelgriff
der einstellbaren Bremse hervor. Sie ermöglicht ein gleichmäßiges
und ruckfreies Handrichten auch bei Schräglagen des Panzers.
Oben auf dem Richtantrieb sind die hornartigen Richtgriffe der
Richtanlage zu erkennen, der sogenannte Steuerposten. An den
Richtgriffen befinden sich je zwei identische
Abfeuerungstaster und je zwei seitliche Handballenschalter, die aus Sicherheitsgründen
erst bei Umfassen der Griffe die elektrohydraulische Richtanlage
freischalten. An der Frontseite der Richtgriffeinrichtung befinden
sich je zwei Potentiometer zum Driftabgleich Höhe und Seite
in den Betriebsarten Hydraulisches Richten/Waffenstabilisierung, der
Umschalter für die Betriebsarten Hydraulisches Richten/Waffenstabilisierung, ein
Betriebstundenzähler und zwei
Kontrollleuchten.. Die linke, grüne Leuchte zeigt den nichtstabilisierten
Betrieb der hydraulischen Richtanlage an, die rechte, gelbe Kontrollleuchte signalisiert
den Betrieb der Waffenstabilisierung. An der rechten Seite der
Kanone, links im Bild, befindet sich der abklappbare Handgriff
der manuellen Höhenrichtanlage mit einem Taster für die elektrische
Abfeuerung. Beim Drehen der Höhenrichtkurbel
wird die Antriebswelle des Hydromotors des Zahnstangen-Richtgetriebes
übersteuert. Bei Nichtbenutzung kann der Handgriff umgeklappt
und eingerastet werden. Ein Erhöhungquadrant (nicht dargestellt)
für das Schießen im indirekten Richten oder nach zuvor ermittelten
Werten
komplettiert die Richtmittel des Schützen. Das linke Bild
zeigt abschließend noch einen Blick auf die Richteinrichtungen
des Schützen. Rechts am Turmdrehkranz befindet sich der elektrohydraulische
Seitenrichtantrieb. An dessen rechter Oberseite befindet sich
die Handrichtkurbel. An der linken Seite ragt der Kugelgriff
der einstellbaren Bremse hervor. Sie ermöglicht ein gleichmäßiges
und ruckfreies Handrichten auch bei Schräglagen des Panzers.
Oben auf dem Richtantrieb sind die hornartigen Richtgriffe der
Richtanlage zu erkennen, der sogenannte Steuerposten. An den
Richtgriffen befinden sich je zwei identische
Abfeuerungstaster und je zwei seitliche Handballenschalter, die aus Sicherheitsgründen
erst bei Umfassen der Griffe die elektrohydraulische Richtanlage
freischalten. An der Frontseite der Richtgriffeinrichtung befinden
sich je zwei Potentiometer zum Driftabgleich Höhe und Seite
in den Betriebsarten Hydraulisches Richten/Waffenstabilisierung, der
Umschalter für die Betriebsarten Hydraulisches Richten/Waffenstabilisierung, ein
Betriebstundenzähler und zwei
Kontrollleuchten.. Die linke, grüne Leuchte zeigt den nichtstabilisierten
Betrieb der hydraulischen Richtanlage an, die rechte, gelbe Kontrollleuchte signalisiert
den Betrieb der Waffenstabilisierung. An der rechten Seite der
Kanone, links im Bild, befindet sich der abklappbare Handgriff
der manuellen Höhenrichtanlage mit einem Taster für die elektrische
Abfeuerung. Beim Drehen der Höhenrichtkurbel
wird die Antriebswelle des Hydromotors des Zahnstangen-Richtgetriebes
übersteuert. Bei Nichtbenutzung kann der Handgriff umgeklappt
und eingerastet werden. Ein Erhöhungquadrant (nicht dargestellt)
für das Schießen im indirekten Richten oder nach zuvor ermittelten
Werten
komplettiert die Richtmittel des Schützen.
 An
der rechten Turmseite unter dem Kommandantensitz ist der Hauptschaltkasten
angebracht. Ihn zeigt das linke Bild. Von oben
links sind folgende Schalter enthalten: Der Tastschalter NEBELWERFER,
der Tastschalter NOTRICHTEN unter einer Schutzklappe, die beiden
Schalter BELÜFTUNG und HEIZUNG für den Kampfraum, darunter
von links nach rechts der
Schalter PUMPENMOTOR für die Hydraulikpumpe der Richtanlage, der Hauptschalter
WAFFEN für die Stromkreise der Abfeuerung, der Richtschützenhauptschalter unter einer Schutzklappe
und die Schalter INSTRUMENTENBELEUCHTUNG und BELEUCHTUNG.
Rechts in der unteren Reihe befindet sich unter einer Schutzklappe
noch der Schalter der Vorheizung des Hydrauliköls der Richtanlage.
In
der unteren Reihe befinden sich die Sicherungsautomaten der
entsprechenden Stromkreise. An
der rechten Turmseite unter dem Kommandantensitz ist der Hauptschaltkasten
angebracht. Ihn zeigt das linke Bild. Von oben
links sind folgende Schalter enthalten: Der Tastschalter NEBELWERFER,
der Tastschalter NOTRICHTEN unter einer Schutzklappe, die beiden
Schalter BELÜFTUNG und HEIZUNG für den Kampfraum, darunter
von links nach rechts der
Schalter PUMPENMOTOR für die Hydraulikpumpe der Richtanlage, der Hauptschalter
WAFFEN für die Stromkreise der Abfeuerung, der Richtschützenhauptschalter unter einer Schutzklappe
und die Schalter INSTRUMENTENBELEUCHTUNG und BELEUCHTUNG.
Rechts in der unteren Reihe befindet sich unter einer Schutzklappe
noch der Schalter der Vorheizung des Hydrauliköls der Richtanlage.
In
der unteren Reihe befinden sich die Sicherungsautomaten der
entsprechenden Stromkreise.
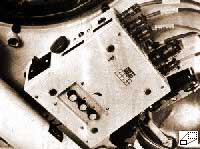 Weitere
Bedienfunktionen für den
Kommandanten befinden sich am Schalterkasten Kommandant/Ladeschütze,
der an der Turmdecke hinter dem Bodenstück der Kanone befestigt
ist. An dessen rechter Seite befinden sich die Schalter für
das Einschalten und Auslösen der rechten oder linken Nebelwerfer
an der Turmaußenseite und Kontrollleuchten für die Feuerbereitschaft
der Nebelwerfer und der Kanone, sowie Kontrollleuchten für die
Fahrerlukenstellung, die Rohranhebeautomatik
beim Richten im Heckbereich und den Schaltzustand des Turmhauptschalters.
Das linke Bild zeigt diesen Schaltkasten aus Sicht des Ladeschützen.
An der linken Seite ist der große Tastschalter für die Freigabe
der Abfeuerung durch den Ladeschützen nach Abschluß des Ladevorganges
angebracht. Eine Kontrollleuchte zeigt den Schaltzustand SCHUSSBEREIT
an. Ein Sicherheitsschalter ermöglicht es dem Ladeschützen, bei
Notwendigkeit die hydraulische Richtanlage außer Funktion zu
setzen. An der unteren Seite des Schaltkastens befinden sich
drei Drehgriffe für das Einstellen von Werten bei Prüfarbeiten
an der Richtanlage. Weitere
Bedienfunktionen für den
Kommandanten befinden sich am Schalterkasten Kommandant/Ladeschütze,
der an der Turmdecke hinter dem Bodenstück der Kanone befestigt
ist. An dessen rechter Seite befinden sich die Schalter für
das Einschalten und Auslösen der rechten oder linken Nebelwerfer
an der Turmaußenseite und Kontrollleuchten für die Feuerbereitschaft
der Nebelwerfer und der Kanone, sowie Kontrollleuchten für die
Fahrerlukenstellung, die Rohranhebeautomatik
beim Richten im Heckbereich und den Schaltzustand des Turmhauptschalters.
Das linke Bild zeigt diesen Schaltkasten aus Sicht des Ladeschützen.
An der linken Seite ist der große Tastschalter für die Freigabe
der Abfeuerung durch den Ladeschützen nach Abschluß des Ladevorganges
angebracht. Eine Kontrollleuchte zeigt den Schaltzustand SCHUSSBEREIT
an. Ein Sicherheitsschalter ermöglicht es dem Ladeschützen, bei
Notwendigkeit die hydraulische Richtanlage außer Funktion zu
setzen. An der unteren Seite des Schaltkastens befinden sich
drei Drehgriffe für das Einstellen von Werten bei Prüfarbeiten
an der Richtanlage.
 Der
Schaltkasten des Richtschützen, den das linke Bild zeigt, umfasst
links oben den Drehknopf zur Dimmung der Kontrollleuchten, darunter den Tastschalter für
die Scheibenheizung der beiden Richtoptiken, den Tastschalter
für den Scheibenwischer vor der Ausblickscheibe des Zielfernrohres,
ganz unten
den Waffenwahlschalter "10,5 cm / MG"
sowie an der rechten Seite einen Prüfschalter für die Waffenstabilisierung
mit Kontrollleuchte und eine Steckdose. Rechts des Schaltkastens
ist der Bedien- und Anschlusskasten des Richtschützens für die
Bordsprechanlage angebracht. Der schwarze Gummi dazwischen dient
als Schutzpolster für die Besatzung.. Der
Schaltkasten des Richtschützen, den das linke Bild zeigt, umfasst
links oben den Drehknopf zur Dimmung der Kontrollleuchten, darunter den Tastschalter für
die Scheibenheizung der beiden Richtoptiken, den Tastschalter
für den Scheibenwischer vor der Ausblickscheibe des Zielfernrohres,
ganz unten
den Waffenwahlschalter "10,5 cm / MG"
sowie an der rechten Seite einen Prüfschalter für die Waffenstabilisierung
mit Kontrollleuchte und eine Steckdose. Rechts des Schaltkastens
ist der Bedien- und Anschlusskasten des Richtschützens für die
Bordsprechanlage angebracht. Der schwarze Gummi dazwischen dient
als Schutzpolster für die Besatzung..
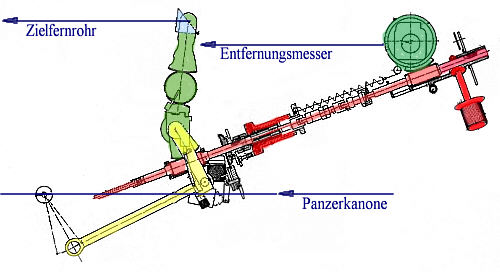 Wegen
seiner konstruktiven Besonderheit hier noch eine Prinzipdarstellung
der mechanischen und optischen Wirkungsweise der Visiereinrichtung
des Panzer 68. Wegen
seiner konstruktiven Besonderheit hier noch eine Prinzipdarstellung
der mechanischen und optischen Wirkungsweise der Visiereinrichtung
des Panzer 68.
Ein Parallelogramgestänge
(gelb) verbindet das kippbare Ausblickprisma des Richtschützenzielfernrohres
(grün, links) mit den Bewegungen der Kanonenwiege. Eine
Verbindungsstange (hellrot) überträgt die vertikalen Bewegungen
der Kanonenwiege gleichlaufend auch an den um seine Längsachse
drehbaren
Entfernungsmesser (grün, rechts). Dadurch sind die Bewegungen
der Kanone sowie der Visierlinien des Zielfernrohres und des Entfernungsmessers
aufeinander abgeglichen. Die zentralen Richtmarken beider Optiken
zeigen auf den gleichen Justierpunkt, der bei 1500 m liegen
soll. Die Verbindungsstange
ist so aufgebaut, dass durch Verdrehen einer integrierten
Spindeleinrichtungen (hellrot) über Schneckengetriebe die
Winkeldifferenz zwischen der Rohrseelenachse und den Visierlinien gleichzeitig
beider
Optiken eingestellt wird. Dies ist sowohl beim Kommandanten als auch beim Richtschützen
möglich (dunkelrot). Diese Winkeldifferenz entspricht dem Erhöhungswinkel
in Abhängigkeit von der gewählten Schußentfernung und Munitionsart.
Für das Schießen bei Nacht sind beim Panzer 68 keinerlei
Infrarot-Nachtsichtgeräte vorhanden.
Entsprechend der üblichen Einsatzverfahren sollte bei Nacht das Gefechtsfeld
durch künstliche Beleuchtung erhellt werden. Dazu wurde später
auf der Turmdecke zwischen der Kommandanten- und der Ladeschützenluke
ein einrohriger Lyran-Werfer montiert. Mit ihm war es möglich
Leuchtgeschosse
abzufeuern. Zum Einstellen der geforderten Entfernung besaß
der Lyran-Werfer eine Wasserwaage mit Leuchtstoff und ein Zahnsegment
im Richtbereich von 0...160°. Die Lage des Leuchtpunktes konnte
darüber hinaus am Leuchtgeschoss durch einen tempierbaren Zünder
und Zusatzladungen bestimmt werden. In der Horizontale wurde
der Lyran-Werfer durch Drehen des gesamten Turmes gerichtet.
Das
Abfeuern erfolgte durch den Kommandanten.
Spätestens Mitte der 80er Jahre war klar,
dass die bisherige optische Ausstattung nicht mehr den Anforderungen
genügen würde. Im Jahre 1988 wurde deshalb der Panzer 68 erneut
modernisiert und mit einem neuen Hauptzielfernrohr PERI-ZL68 der Firma Carl Zeiss Optronik
ausgestattet. Die modernisierte Version erhielt die Bezeichnung
Panzer 68/88.
Die ursprünglichen Panzer 68 wurde bis in Jahr 1999 und die
modernisierte Panzer 68/88 bis ins Jahre 2004
eingesetzt. In Folge der Auflösung der mit ihnen ausgerüsteten Panzerbataillone
wurden sie
zunächst eingelagert und nach erfolglosen Verkaufsbemühungen bis auf wenige
Sammlerexemplare verschrottet. Somit ging
die nicht
immer einfache, aber letztendlich durchaus erfolgreiche Epoche
der Schweizer Kampfpanzerentwicklung nach über 47 Jahren zu Ende.
Mit freundlicher
Unterstützung durch das Schweizerische
Militärmuseum Full

und durch das Schweizer
Armeemuseum, das weitere Informationen bietet.

|




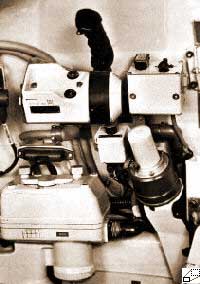



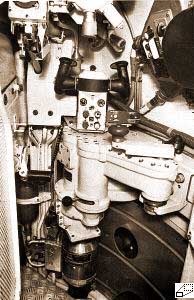

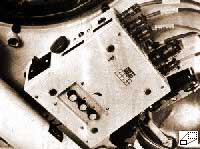

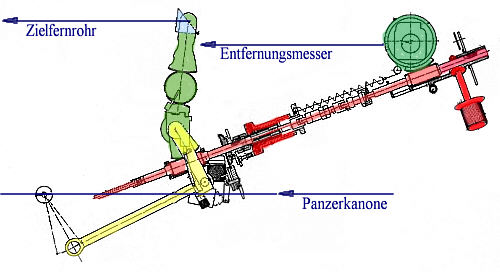 Wegen
seiner konstruktiven Besonderheit hier noch eine Prinzipdarstellung
der mechanischen und optischen Wirkungsweise der Visiereinrichtung
des Panzer 68.
Wegen
seiner konstruktiven Besonderheit hier noch eine Prinzipdarstellung
der mechanischen und optischen Wirkungsweise der Visiereinrichtung
des Panzer 68. 
