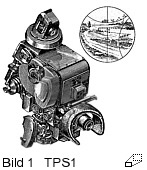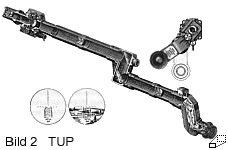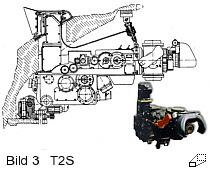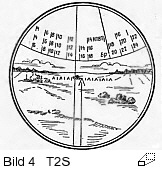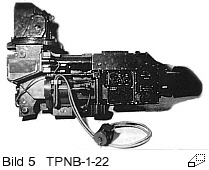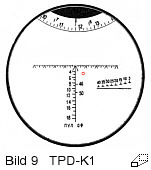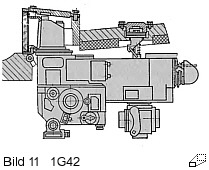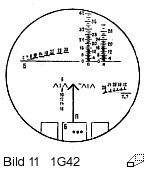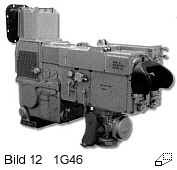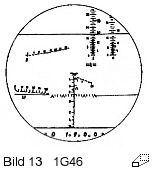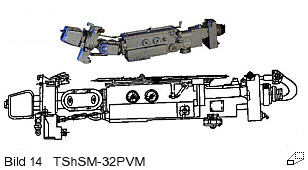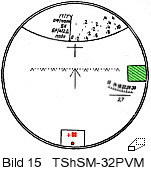|

|
Aus der Geschichte der sowjetischen
Panzerzielfernrohre
Während der langen Kriegsjahre
war die gesamte Kraft der sowjetischen Wirtschaft auf eine technologisch
vereinfachte Massenproduktion
konzentriert worden. Erfolgversprechende, aber technologisch
aufwändige Entwicklungen der Vorkriegszeit waren zurückgestellt
worden, da weder die erforderlichen personellen noch die wirtschaftlichen
Ressourcen frei gemacht werden konnten. Im Jahre 1945, nach
dem Sieg und der Umstellung der Rüstungsbetriebe auf die
Friedensproduktion, nahm man in der Sowjetunion unverzüglich
die Entwicklungsarbeiten wieder auf. Während des Krieges
waren alle Konstruktionsvorhaben mit dem Ziel geführt worden,
in erster Linie den Panzerschutz und die Feuerkraft der vorhandenen
Panzer zu verbessern, nun rückten wieder neuartige Technologien
in den Schwerpunkt der Entwicklung. Insbesondere die Ausstattung
mit modernen Feuerleitgeräten wurde nach den Auswertungen
des Weltkrieges als außerordentlich wichtig eingestuft.
Die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Waffenstabilisierungsanlagen
begannen mit Nachdruck ebenfalls bereits kurz nach Kriegsende, weil die
sowjetischen Ansichten die Fähigkeit der Panzer zur Feuerführung
aus der Bewegung im Gegensatz zu den westlichen Militärs
als entscheidend für den Gefechtsverlauf ansahen. Es gelang
den sowjetischen Konstrukteuren bis Anfang der 80er Jahre einen
Vorsprung bei der Entwicklung moderner Waffenstabilisierungsanlagen
und von Zielfernrohren mit unabhängiger Stabilisierung
der Visierlinie in zwei Ebenen herauszuarbeiten. Der technologische
Vorsprung ging verloren, als im Westen mit dem Leopard 2
und dem M1A1 hochmoderne Elektronik in die Ausstattung der Feuerleitanlagen Einzug hielt. Schwerwiegend machte sich das
besonders auf dem Gebiet der Nachtsichttechnologie bemerkbar.
Die Sowjetunion verfügte ab etwa den 70er Jahren aus verschiedenen
Gründen offensichtlich über keine freien Ressourcen für die Forschung im Bereich der Wärmebildtechnik.
Der neue russische Kampfpanzer T-90 ist letztlich
mit einem Zielfernrohr 1G46 ausgestattet, dessen technologische
Grundlagen auf einer Nachkriegsentwicklung beruhen. Ein leistungsfähiges
Wärmebildgerät musste in Frankreich eingekauft werden.
Inzwischen stehen hochmoderne Zielfernrohre und Feuerleitanlagen
zur Verfügung, die keinen internationalen Vergleich scheuen
müssen. Ihr Einsatz in Kampfpanzern wird jedoch noch einige
Zeit auf sich warten lassen. Die russische Militärdoktrin
hat sich der neuen internationalen Sicherheitslage angepasst,
die den klassischen Krieg mit großen Panzerverbänden
in immer weitere Ferne rücken lässt und die bei der Ausrüstung
der Streitkräfte auf andere Schwerpunkte setzt.
Der Artikel unterliegt der weiteren Fortschreibung. Stand 14.07.2009
Teil 1
Teil 2 Tabellen,
Bildquellen, Literatur
Sowjetische
Panzerzielfernrohre ab Mitte der fünfziger Jahre
Unverzüglich nach Kriegsende
begannen die sowjetischen Konstruktionsbüros die Vorkriegsentwicklungen
erneut aufzugreifen und unter Beachtung der Kriegserfahrungen
für die Arbeiten an den Kampfpanzern der Zukunft nutzbar
zu machen. Für die 100 mm Kanone D-10T des T-54 entstand
bereits 1945 ein Zielfernrohr mit stabilisierter Visierlinie
in der Vertikalen, das die Idee des TOS von 1938 aufgriff. Die
unstabilisierte Kanone wurde durch eine Kreiselbaugruppe in
dem Moment abgefeuert, in dem die unstabilisierte Kanone durch
die der Schussentfernung entsprechende Erhöhungslinie durchschwang.
Die Arbeiten wurden weitergeführt in Verbindung mit einer
vorgesehenen Waffenstabilisierunganlage für die 85 mm
Kanone SIS-S-53 des T-34/85. Im Jahre 1953 wurden diese Arbeiten dann offiziell beendet,
nicht zuletzt wegen der fortgeschrittenen Arbeiten an modernen
Waffenstabilisierungsanlagen für den T-54 und andere Kampfpanzer..
Während
nach unterschiedlichsten Erprobungen für die T-54/55 und
sogar für den T-62 endgültig die Entscheidung für
das 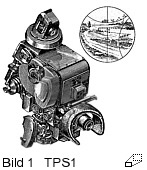 unstabilisierte
Zielfernrohr Typ TSh2 gefallen war, ging man bei der Entwicklung
der schweren Panzer einen anderen Weg. Den schweren Panzern
hatte die sowjetische Militärtheorie eine höhere taktische
Wertigkeit zugemessen als den massenhaft hergestellten Linienpanzern.
Das spiegelt sich folgerichtig auch in der Ausstattung mit hochwertigen
optischen Geräten und Zielfernrohren wider. Allerdings
hatten bei der Entscheidung, vorrangig die schweren Panzer bevorzugt
mit modernsten Zielfernrohren auszurüsten, die begrenzten
Produktionskapazitäten der Hersteller optischer Geräte
eine wichtige, vielleicht sogar die entscheidende Rolle gespielt. Nach dem IS-3 und dem modernisierten
IS-3M, die beide noch mit dem einfachen TSh-17 ausgestattet
waren, war es vor allem der letzte in Serie gefertigte schwere
Panzer T-10, der Ende der 50er Jahre ein Beispiel modernster Panzerbautechnologie
darstellt. In der Modifikation T-10A mit der 122 mm Kanone
D-25T hatte dieser schwere Panzer im Jahre 1956 international erstmalig ein
Zielfernrohr erhalten, das eine unabhängig stabilisierte
Visierlinie in der vertikalen Ebene besaß und dessen 2-Ebenen
Waffenstabilisierungsanlage in der Vertikalen der stabilisierten
Visierlinie nachgeführt wurde. Dieses Zielfernrohr TPS1
war eine international absolut neuartige Entwicklung und unterschied
sich konstruktiv ganz deutlich von allen bisherigen Zielfernrohren.
In einem Aluminiumdruckgussgehäuse war ein groß dimensionierter,
in drei Freiheitsgraden aufgehängter
Kreisel, ein sogenannter Schießautomat und die Optik
des Zielfernrohres mit der Entfernungsskala untergebracht. Ein
von Hand seitlich verstellbarer senkrechter Strich erleichtert
dem Richtschützen das Schießen mit Vorhalte und Windkorrektur. Eine
automatische Berücksichtigung der Vorhalte, wie auch aller
anderen ballistischen und meteorologischen Abweichungen von
den Normalbedingungen des Schießens, war beim TPS1 jedoch
noch nicht vorgesehen. Der
in drei Freiheitsgraden kardanisch aufgehängte
Kreisel war mit dem beweglichen Ausblickspiegel mechanisch verbunden
und stabilisierte auf diesem Wege die Visierline in der vertikalen
Ebene. Durch die an der kardanischen Kreiselaufhängung angebrachten
Drehmelder und elektrischen Richtmagnete wurde die Kanonenstabiliserung
in der Vertikalen angesteuert und der Visierlinie nachgeführt.
Die Entfernung wurde mit Hilfe einer nockenwellenartigen Ballstikeinrichtung
mit drei Kurvenscheiben für die Panzergranate BR-471B und
die Splittersprenggranate OF-471N, beide mit einem Einstellbereich
bis maximal 5000 Meter, sowie für das 12,7 mm
Koaxialmaschinengewehr DShKM bis maximal 2900 Meter eingestellt. Der Schießautomat, ein Bestandteil der Kreiseleinrichtung,
arbeitete analog der Kreiselabfeuerung, wie sie schon im TOS
des BT-7M eingebaut war. Über ein unstabilisierte
Zielfernrohr Typ TSh2 gefallen war, ging man bei der Entwicklung
der schweren Panzer einen anderen Weg. Den schweren Panzern
hatte die sowjetische Militärtheorie eine höhere taktische
Wertigkeit zugemessen als den massenhaft hergestellten Linienpanzern.
Das spiegelt sich folgerichtig auch in der Ausstattung mit hochwertigen
optischen Geräten und Zielfernrohren wider. Allerdings
hatten bei der Entscheidung, vorrangig die schweren Panzer bevorzugt
mit modernsten Zielfernrohren auszurüsten, die begrenzten
Produktionskapazitäten der Hersteller optischer Geräte
eine wichtige, vielleicht sogar die entscheidende Rolle gespielt. Nach dem IS-3 und dem modernisierten
IS-3M, die beide noch mit dem einfachen TSh-17 ausgestattet
waren, war es vor allem der letzte in Serie gefertigte schwere
Panzer T-10, der Ende der 50er Jahre ein Beispiel modernster Panzerbautechnologie
darstellt. In der Modifikation T-10A mit der 122 mm Kanone
D-25T hatte dieser schwere Panzer im Jahre 1956 international erstmalig ein
Zielfernrohr erhalten, das eine unabhängig stabilisierte
Visierlinie in der vertikalen Ebene besaß und dessen 2-Ebenen
Waffenstabilisierungsanlage in der Vertikalen der stabilisierten
Visierlinie nachgeführt wurde. Dieses Zielfernrohr TPS1
war eine international absolut neuartige Entwicklung und unterschied
sich konstruktiv ganz deutlich von allen bisherigen Zielfernrohren.
In einem Aluminiumdruckgussgehäuse war ein groß dimensionierter,
in drei Freiheitsgraden aufgehängter
Kreisel, ein sogenannter Schießautomat und die Optik
des Zielfernrohres mit der Entfernungsskala untergebracht. Ein
von Hand seitlich verstellbarer senkrechter Strich erleichtert
dem Richtschützen das Schießen mit Vorhalte und Windkorrektur. Eine
automatische Berücksichtigung der Vorhalte, wie auch aller
anderen ballistischen und meteorologischen Abweichungen von
den Normalbedingungen des Schießens, war beim TPS1 jedoch
noch nicht vorgesehen. Der
in drei Freiheitsgraden kardanisch aufgehängte
Kreisel war mit dem beweglichen Ausblickspiegel mechanisch verbunden
und stabilisierte auf diesem Wege die Visierline in der vertikalen
Ebene. Durch die an der kardanischen Kreiselaufhängung angebrachten
Drehmelder und elektrischen Richtmagnete wurde die Kanonenstabiliserung
in der Vertikalen angesteuert und der Visierlinie nachgeführt.
Die Entfernung wurde mit Hilfe einer nockenwellenartigen Ballstikeinrichtung
mit drei Kurvenscheiben für die Panzergranate BR-471B und
die Splittersprenggranate OF-471N, beide mit einem Einstellbereich
bis maximal 5000 Meter, sowie für das 12,7 mm
Koaxialmaschinengewehr DShKM bis maximal 2900 Meter eingestellt. Der Schießautomat, ein Bestandteil der Kreiseleinrichtung,
arbeitete analog der Kreiselabfeuerung, wie sie schon im TOS
des BT-7M eingebaut war. Über ein 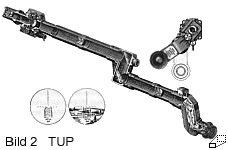 Parallelogrammgestänge
mit der stabilisierten Kanone verbunden, löst sie die
elektromechanische Abfeuerung in genau dem Moment aus, in dem
die Rohrerhöhung korrekt mit der eingestellten Schussentfernung
übereinstimmt. Um dem Richtschützen die Bestimmung
der Entfernung zu erleichtern, hatten die Entwickler drei wahlweise
einschwenkbare Entfernungsmessskalen im Sichtfeld untergebracht.
Das waren eine Skala mit 1,2 Meter Basishöhe für
Panzerabwehrwaffen, eine Skala mit 2,7 Meter Basishöhe
für mittlere Kampfpanzer und eine Skala mit 3 Meter
Basishöhe für schwere Panzer. Bei nichtstabilisierter
oder während des Ladevorganges arretierter Kanone konnte
der Richtschütze die Beobachtung mit stabilisertem Sichtfeld
führen und den Turm erforderlichenfalls elektrisch drehen. Das
Sichtfeld konnte zwischen einer 3,1-fachen und einer 8-fachen
Vergrößerung umgestellt werden.
In seinem Aufbau und seiner Funktionalität ist das
TPS1
mithin der Vater aller weiteren modernen, unabhängig
stabilisierten sowjetischen Zielfernrohre. Bemerkenswert ist, dass für
den T-10A erstmals wieder ein zusätzliches Hilfszielfernrohr TUP vorgesehen
war, nach dem man im Kriegsverlauf vom Einbau eines
zweiten Zielfernrohres Abstand genommen hatte. Und es sollte
in Zukunft, nach dem T-10A, auch nie wieder ein solches Hilfszielfernrohr in
einen sowjetischen Panzer
eingebaut werden. Das TUP ist links neben der Kanone untergebracht
und besitzt kein optisches Gelenk, das Okular folgt also den
vertikalen Richtbewegungen. Auf dem statischen Strichbild finden
sich die Entfernungsmarken für die Panzergranate BR-471B
mit einer maximalen Schussweite von 3400 Meter und für
das 12,7 mm Koaxialmaschinengewehr DShKM bis maximal 1000 Meter,
sowie entsprechende horizontale Vorhaltemarken. Zur Anpassung
an die Position des Richtschützen kann das Okularteil seitlich
verdreht werden. Ein Grund für den Einbau dieses Hilfszielfernrohres
mag gewesen sein, dass die Zuverlässigkeit des Hauptzielfernrohres
TPS1 nicht so hoch war wie gefordert. Noch beim Nachfolger, dem T2S, hatten die Entwickler besondere Anstrengungen auf die
Konstruktion der Zielfernrohraufhängung gelegt, um die
Übertragung unerwünschter
Vibrationen auf das Zielfernrohr auszuschließen. Parallelogrammgestänge
mit der stabilisierten Kanone verbunden, löst sie die
elektromechanische Abfeuerung in genau dem Moment aus, in dem
die Rohrerhöhung korrekt mit der eingestellten Schussentfernung
übereinstimmt. Um dem Richtschützen die Bestimmung
der Entfernung zu erleichtern, hatten die Entwickler drei wahlweise
einschwenkbare Entfernungsmessskalen im Sichtfeld untergebracht.
Das waren eine Skala mit 1,2 Meter Basishöhe für
Panzerabwehrwaffen, eine Skala mit 2,7 Meter Basishöhe
für mittlere Kampfpanzer und eine Skala mit 3 Meter
Basishöhe für schwere Panzer. Bei nichtstabilisierter
oder während des Ladevorganges arretierter Kanone konnte
der Richtschütze die Beobachtung mit stabilisertem Sichtfeld
führen und den Turm erforderlichenfalls elektrisch drehen. Das
Sichtfeld konnte zwischen einer 3,1-fachen und einer 8-fachen
Vergrößerung umgestellt werden.
In seinem Aufbau und seiner Funktionalität ist das
TPS1
mithin der Vater aller weiteren modernen, unabhängig
stabilisierten sowjetischen Zielfernrohre. Bemerkenswert ist, dass für
den T-10A erstmals wieder ein zusätzliches Hilfszielfernrohr TUP vorgesehen
war, nach dem man im Kriegsverlauf vom Einbau eines
zweiten Zielfernrohres Abstand genommen hatte. Und es sollte
in Zukunft, nach dem T-10A, auch nie wieder ein solches Hilfszielfernrohr in
einen sowjetischen Panzer
eingebaut werden. Das TUP ist links neben der Kanone untergebracht
und besitzt kein optisches Gelenk, das Okular folgt also den
vertikalen Richtbewegungen. Auf dem statischen Strichbild finden
sich die Entfernungsmarken für die Panzergranate BR-471B
mit einer maximalen Schussweite von 3400 Meter und für
das 12,7 mm Koaxialmaschinengewehr DShKM bis maximal 1000 Meter,
sowie entsprechende horizontale Vorhaltemarken. Zur Anpassung
an die Position des Richtschützen kann das Okularteil seitlich
verdreht werden. Ein Grund für den Einbau dieses Hilfszielfernrohres
mag gewesen sein, dass die Zuverlässigkeit des Hauptzielfernrohres
TPS1 nicht so hoch war wie gefordert. Noch beim Nachfolger, dem T2S, hatten die Entwickler besondere Anstrengungen auf die
Konstruktion der Zielfernrohraufhängung gelegt, um die
Übertragung unerwünschter
Vibrationen auf das Zielfernrohr auszuschließen.
Nur kurze Zeit nach dem TPS1
war auch eine weitere Neukonstruktion soweit entwickelt, dass
sie prinzipiell produktionsreif erschien. Es handelt sich um
das Zielfernrohr T2S. Weltweit erstmalig hatte ein Zielfernrohr
eine unabhängige Stabilisierung der Visierlinie nicht nur
in der Vertikalen, sondern auch in der Horizontalen erhalten.
Die Stabilisierung der Visierlinie erfolgte dabei nach dem selben
Prinzip, wie schon beim TPS1. Ein Kreisel mit drei Freiheitsgraden
im Zielfernrohrblock gewährleistete die vertikale Stabilisierung
des oberen Ausblickspiegels auf rein mechanischem Wege mit sehr
hoher Präzision. Die Besonderheit besteht darin, das der
Kreisel zusätzlich über eine mechanische Einrichtung
mit dem horizontal beweglichen, unteren zweiten Spiegel verbunden ist, der für die Stabilisierung
der Visierlinie in der Horizontalen verantwortlich ist. Dieses
Prinzip war in seiner Stabilisierungsgüte und der 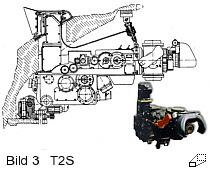 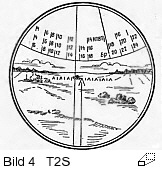 mechanischen
Zuverlässigkeit so erfolgreich, dass es später in allen
weiteren Zielfernrohren bis hin zum 1G64 der T-90 zum Einatz
kam. Die Kreiselbaugruppe stellt neben der Visierlinienstabilisierung
gleichfalls die zentrale Baugruppe der Stabilisierung von Kanone
und Turm dar. Über Resolver werden die Signale für
die Stabilisierungselektronik ausgegeben und in dieser mit den
zusätzlichen Signalen der Winkelgeschwindigkeitsgeber für die Vertikale
und die Horizontale gemischt. Das resultierende Signal wird
verstärkt und an die Richteinrichtung des Turms und der
Kanone ausgegeben. Der Block der Winkelgeschwindigkeitsgeber
ist unterhalb des Bodenstücks der Kanone angebracht und
stellt somit faktisch den kombinierten Turm- und Waffenkreisel
dar. Die Schussentfernung wird wie schon beim TPS1 manuell eingestellt.
Für das Schießen mit seitlichem Vorhalt auf bewegliche
Ziele und aus der Bewegung sowie bei Seitenwind kann
ein senkrechter Strich horizontal auf den entsprechenden Vorhaltewert
verstellt werden. Die Vorhalte wird anschließend durch
Anrichten mit dem Kreuzungspunkt zwischen senkrechtem Vorhaltestrich
und horizontaler Linie der Vorhaltemarken berücksichtigt.
Der Schuss wird durch den Schießautomaten erst ausgelöst,
wenn die erforderliche Koinzidenz in der vertikalen und der
horizontalen Ebene gegeben ist. Bei ausgeschaltetem Stabilisator
arbeitet das T2S wie ein herkömmliches Zielfernrohr und
folgt den Richtbewegungen von Turm und Kanone. Bei eingeschalteter
Visierlinienstabilisierung, aber ausgeschaltetem Waffenstabilisator
kann der Turm elektromechanisch geschwenkt und mit stabilisiertem
Sichtfeld beobachtet werden, was besonders während des
Ladevorganges bedeutsam ist, wenn die Waffenstabilisierung kurzzeitig
blockiert ist. Die Hauptbetriebsart ist die unabhängige
Visierlinienstabilisierung bei nachgeführter Waffenstabilisierung.
Die Entfernungseinstellung erfolgt analog wie beim TPS1 über
eine nockenwellenartigen Ballistikeinrichtung
mit drei Kurvenscheiben für die Panzersprenggranate BR-471B bei
einem Einstellbereich bis 4000 Meter und
die Splittersprenggranate OF-471N mit einem Einstellbereich
bis maximal 6000 Meter, sowie für das 14,5 mm
Koaxialmaschinengewehr KPVT bis maximal 2000 Meter.
Interessant beim T2S ist, dass die Längsachse der Richtgriffeinheit
auf der optischen Achse des Fernrohrteils liegt. Der Richtschütze
schaut faktisch durch die Richtgriffbaugruppe hindurch. Die
dabei notwendige Haltung der Hände in relativ hoher Position
scheint aus Sicht der Ergonomie nicht den Zuspruch der Truppe
gefunden zu haben, denn alle nachfolgenden Zielfernrohre haben
die Richtgriffe wieder unterhalb des Zielfernrohrgehäuses,
wie schon beim TPS1. Am Zielfernrohrgehäuse befinden sich
die üblichen Bedienelemente, wie der Vergrößerungswechsler,
eine Sonnenblende und die Betätigung der mechanischen Freigabe
des Stabilisierungskreisels. Der manuelle Entfernungseinstellring
befindet sich direkt zwischen dem Richtgriff und dem Okular
mit Stirnschutz und kann dadurch mit den Daumen des Richtschützen
sehr bequem erreicht werden. Für das Schießen mit
dem Infrarot-Nachtzielfernrohr TPN-1 musste das T2S auf Nachtbetrieb
umgeschaltet werden.
Auf ein gesondertes Hilfszielfernrohr
war verzichtet worden. Das rührt zum einen offenbar aus
der inzwischen erreichten hohen Zuverlässigkeit des T2S
her und zum anderen aus dem Umstand, das links des T2S ein aktives
Infrarotzielfernrohr TPN-1 eingebaut wurde. Die Forderung nach
dem Einbau eines zweiten, völlig autonomen Zielfernrohrs
war auch den sowjetischen Konstrukteuren klar und sie gelangten
nach zahlreichen Ausfallanalysen zu dem Schluss, dass
das Nachtzielfernrohr bei Ausfall des Hauptzielfernrohres durchaus
auch am Tage als Hilfszielfernrohr verwendet werden konnte.
Aus Gründen der Kostenrechnung, der Gewichtseinsparung
und der effizienten Nutzung des knapp bemessenen Turminnenvolumens
eine vertretbare Lösung. mechanischen
Zuverlässigkeit so erfolgreich, dass es später in allen
weiteren Zielfernrohren bis hin zum 1G64 der T-90 zum Einatz
kam. Die Kreiselbaugruppe stellt neben der Visierlinienstabilisierung
gleichfalls die zentrale Baugruppe der Stabilisierung von Kanone
und Turm dar. Über Resolver werden die Signale für
die Stabilisierungselektronik ausgegeben und in dieser mit den
zusätzlichen Signalen der Winkelgeschwindigkeitsgeber für die Vertikale
und die Horizontale gemischt. Das resultierende Signal wird
verstärkt und an die Richteinrichtung des Turms und der
Kanone ausgegeben. Der Block der Winkelgeschwindigkeitsgeber
ist unterhalb des Bodenstücks der Kanone angebracht und
stellt somit faktisch den kombinierten Turm- und Waffenkreisel
dar. Die Schussentfernung wird wie schon beim TPS1 manuell eingestellt.
Für das Schießen mit seitlichem Vorhalt auf bewegliche
Ziele und aus der Bewegung sowie bei Seitenwind kann
ein senkrechter Strich horizontal auf den entsprechenden Vorhaltewert
verstellt werden. Die Vorhalte wird anschließend durch
Anrichten mit dem Kreuzungspunkt zwischen senkrechtem Vorhaltestrich
und horizontaler Linie der Vorhaltemarken berücksichtigt.
Der Schuss wird durch den Schießautomaten erst ausgelöst,
wenn die erforderliche Koinzidenz in der vertikalen und der
horizontalen Ebene gegeben ist. Bei ausgeschaltetem Stabilisator
arbeitet das T2S wie ein herkömmliches Zielfernrohr und
folgt den Richtbewegungen von Turm und Kanone. Bei eingeschalteter
Visierlinienstabilisierung, aber ausgeschaltetem Waffenstabilisator
kann der Turm elektromechanisch geschwenkt und mit stabilisiertem
Sichtfeld beobachtet werden, was besonders während des
Ladevorganges bedeutsam ist, wenn die Waffenstabilisierung kurzzeitig
blockiert ist. Die Hauptbetriebsart ist die unabhängige
Visierlinienstabilisierung bei nachgeführter Waffenstabilisierung.
Die Entfernungseinstellung erfolgt analog wie beim TPS1 über
eine nockenwellenartigen Ballistikeinrichtung
mit drei Kurvenscheiben für die Panzersprenggranate BR-471B bei
einem Einstellbereich bis 4000 Meter und
die Splittersprenggranate OF-471N mit einem Einstellbereich
bis maximal 6000 Meter, sowie für das 14,5 mm
Koaxialmaschinengewehr KPVT bis maximal 2000 Meter.
Interessant beim T2S ist, dass die Längsachse der Richtgriffeinheit
auf der optischen Achse des Fernrohrteils liegt. Der Richtschütze
schaut faktisch durch die Richtgriffbaugruppe hindurch. Die
dabei notwendige Haltung der Hände in relativ hoher Position
scheint aus Sicht der Ergonomie nicht den Zuspruch der Truppe
gefunden zu haben, denn alle nachfolgenden Zielfernrohre haben
die Richtgriffe wieder unterhalb des Zielfernrohrgehäuses,
wie schon beim TPS1. Am Zielfernrohrgehäuse befinden sich
die üblichen Bedienelemente, wie der Vergrößerungswechsler,
eine Sonnenblende und die Betätigung der mechanischen Freigabe
des Stabilisierungskreisels. Der manuelle Entfernungseinstellring
befindet sich direkt zwischen dem Richtgriff und dem Okular
mit Stirnschutz und kann dadurch mit den Daumen des Richtschützen
sehr bequem erreicht werden. Für das Schießen mit
dem Infrarot-Nachtzielfernrohr TPN-1 musste das T2S auf Nachtbetrieb
umgeschaltet werden.
Auf ein gesondertes Hilfszielfernrohr
war verzichtet worden. Das rührt zum einen offenbar aus
der inzwischen erreichten hohen Zuverlässigkeit des T2S
her und zum anderen aus dem Umstand, das links des T2S ein aktives
Infrarotzielfernrohr TPN-1 eingebaut wurde. Die Forderung nach
dem Einbau eines zweiten, völlig autonomen Zielfernrohrs
war auch den sowjetischen Konstrukteuren klar und sie gelangten
nach zahlreichen Ausfallanalysen zu dem Schluss, dass
das Nachtzielfernrohr bei Ausfall des Hauptzielfernrohres durchaus
auch am Tage als Hilfszielfernrohr verwendet werden konnte.
Aus Gründen der Kostenrechnung, der Gewichtseinsparung
und der effizienten Nutzung des knapp bemessenen Turminnenvolumens
eine vertretbare Lösung.
Das T2S wurde im Objekt 140
erprobt, wo insbesondere wichtige Erfahrungen zur Vermeidung
unerwünschter Schwingungen gesammelt wurden. Vermutlich
sprach allerdings die begrenzte Produktionskapazität des
Herstellers gegen einen Einsatz in einem Kampfpanzer für
die Massenproduktion und so fiel die Entscheidung, das T2S lediglich
in modernisierte T-10B und die T-10M einzubauen.
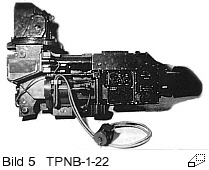 Die
Kombination von Tagkanal und Nachtsichtkanal war auch für
die sowjetischen Entwicklerteams eine interessante Möglichkeit,
Kosten, Gewicht und Einbauvolumen zu sparen. In den Jahren 1961
bis 1962 entwickelten Konstrukteure in den optisch-mechanischen
Werken in Sagorsk für den Einsatz mit der 100 mm Kanone
D-10T2S des T-55 das kombinierte Zielfernrohr TPNB-1-22. Es
enthält den Tagkanal und einen Infrarotkanal in einem Gehäuseblock.
Der Ausblick erfolgt über einen gemeinsamen Ausblickspiegel
im Turmdach. Der Tagkanal besaß eine 3,5- bzw. 7-fache
Vergrößerung, der Nachtkanal eine 6-fache Vergrößerung.
Der Nachtkanal war bereits mit einer automatischen Blende zum
Schutz vor Lichtblitzen, einer Vorhangblende und einer Iris-Blende
ausgestattet. Die Sichtweite bei Nacht und ausreichendem Restlicht
sollte 800 Meter betragen. Wegen verschiedener Probleme
mit der Zuverlässigkeit des Bildwandlers beim Schießen
mit der Kanone und vor allem wegen der in den Erprobungen ermittelten
tatsächlichen, enttäuschend geringen Sichtweite von maximal
600 Metern wurde dieses Projekt jedoch eingestellt. Die
Kombination von Tagkanal und Nachtsichtkanal war auch für
die sowjetischen Entwicklerteams eine interessante Möglichkeit,
Kosten, Gewicht und Einbauvolumen zu sparen. In den Jahren 1961
bis 1962 entwickelten Konstrukteure in den optisch-mechanischen
Werken in Sagorsk für den Einsatz mit der 100 mm Kanone
D-10T2S des T-55 das kombinierte Zielfernrohr TPNB-1-22. Es
enthält den Tagkanal und einen Infrarotkanal in einem Gehäuseblock.
Der Ausblick erfolgt über einen gemeinsamen Ausblickspiegel
im Turmdach. Der Tagkanal besaß eine 3,5- bzw. 7-fache
Vergrößerung, der Nachtkanal eine 6-fache Vergrößerung.
Der Nachtkanal war bereits mit einer automatischen Blende zum
Schutz vor Lichtblitzen, einer Vorhangblende und einer Iris-Blende
ausgestattet. Die Sichtweite bei Nacht und ausreichendem Restlicht
sollte 800 Meter betragen. Wegen verschiedener Probleme
mit der Zuverlässigkeit des Bildwandlers beim Schießen
mit der Kanone und vor allem wegen der in den Erprobungen ermittelten
tatsächlichen, enttäuschend geringen Sichtweite von maximal
600 Metern wurde dieses Projekt jedoch eingestellt.
Das TPS1 und auch das T2S
wurden ab Mitte der 50er Jahre mit einem optischen Entfernungsmesser
kombiniert. Dazu wurde ein zusätzlicher optischer Kanal
neben dem Okular eingebaut, der mit einem Basisrohr im Turm
verbunden war. Aus dem TPS1 entstand in den Jahren 1956-1975
auf diesem Weg das TPDS mit einer Messbasis von 1100 mm. Das in
der vertikalen Ebene unabhängig stabilisierte TPDS
wurde Ende 1957 im Objekt 430, dem Urvater des T-64, erprobt.
Aus dem T2S wurde nach dem selben Prinzip das TPD2S weiter entwickelt,
dessen Messbasis aber wegen der Platzverhältnisse im Turm des
schweren Erprobungspanzers
nur 1000 mm betrug. Der Messbereich der beiden Zielfernrohr-Entfernungsmesser
betrug 1000 bis 4000 Meter, bei einem mittleren Messfehler
von 3% bis 2000 Meter, von 4% bis 3000 Meter und 5%
bis 4000 Meter Entfernung. Das in zwei Ebenen unabhängig
stabilisierte TPD2S war bereits mit einer
Einrichtung zur automatischen Einstellung der gemessenen Schussentfernung
ausgestattet und berücksichtigte auch die Veränderung
der eingestellten Entfernung bei Bewegung des eigenen Panzers
in Abhängigkeit von Turmstellung und Kurswinkel zum Ziel. Das TPD2S wurde
von 1959 bis 1960 in den schweren Experimentalpanzern
Objekt 277 und Objekt 770 erprobt und erfüllte
alle Anforderungen. Die Projekte wurden nicht mehr realisiert,
weil die Entwicklung von schweren Panzern wegen der gestiegenen
Leistungsfähigkeit der mittleren Kampfpanzer und deren
Bewaffnung auch international inzwischen eingestellt worden
war.
Die gewonnen Erfahrungen
mit dem TPS1 und dem T2S und deren Weiterentwicklung mit optischem
Entfernungsmesser flossen Anfang der 60er Jahre in die Entwicklung
des Zielfernrohres TPD-43 bzw. TPD-43B ein. Das TPD-43 vereinigt
in sich die Vorzüge des TPDS und des TPD2S. Die Visierlinie
wird wiederum über eine Kreiselbaugruppe mechanisch in
der vertikalen Ebene stabilisiert. Im Gehäuse verlaufen
der optische Kanal des Zielfernrohres mit einer festen 8-fachen Vergrößerung
bei einem Sichtfeld von 9 Grad und der optische Kanal des monokularen
Entfernungsmessers
mit der selben 8-fachen Vergrößerung, aber einem
Sichtfeld von lediglich 2 Grad. Der Richtschütze   beobachtet
mit dem linken Auge durch das Zielfernrohr und mit dem rechten
Auge durch den Entfernungsmesser. Durch Betätigen
der beiden Messtaster an den Richtgriffen wird die Entfernungsmesseinrichtung
elektromechanisch betätigt. Zur Verbesserung der Messgenauigkeit
wurde die Messbasis auf 1200 mm vergrößert.
Ähnlich wie beim TPDS betrug der Messbereich 1000 bis
4000 Meter bei einer Genauigkeit von 3 - 5 %. Die Messung
erfolgte nach dem Schnittbildverfahren, dabei mussten die beiden
Teilbilder eines horizontal geschnittenen Bildes des Ziels aufeinander
abgestimmt werden. War der für eine präzise Messung
erforderliche Zielkontrast wegen Sichtbehinderungen oder in
der Dämmerung nicht gegeben, konnte beim Nachfolger, dem
TPD-2, das optische System
auf eine Messung nach linker Zielkontur umgestellt werden. Zwei
gleiche Abbilder des Ziels sollten dazu mit ihrer linken Kante
im horizontal geteilten Bild übereinstimmend an einem oberen
bzw. einem unteren Messstrich ausgerichtet werden. beobachtet
mit dem linken Auge durch das Zielfernrohr und mit dem rechten
Auge durch den Entfernungsmesser. Durch Betätigen
der beiden Messtaster an den Richtgriffen wird die Entfernungsmesseinrichtung
elektromechanisch betätigt. Zur Verbesserung der Messgenauigkeit
wurde die Messbasis auf 1200 mm vergrößert.
Ähnlich wie beim TPDS betrug der Messbereich 1000 bis
4000 Meter bei einer Genauigkeit von 3 - 5 %. Die Messung
erfolgte nach dem Schnittbildverfahren, dabei mussten die beiden
Teilbilder eines horizontal geschnittenen Bildes des Ziels aufeinander
abgestimmt werden. War der für eine präzise Messung
erforderliche Zielkontrast wegen Sichtbehinderungen oder in
der Dämmerung nicht gegeben, konnte beim Nachfolger, dem
TPD-2, das optische System
auf eine Messung nach linker Zielkontur umgestellt werden. Zwei
gleiche Abbilder des Ziels sollten dazu mit ihrer linken Kante
im horizontal geteilten Bild übereinstimmend an einem oberen
bzw. einem unteren Messstrich ausgerichtet werden.
Das
TPD-43B wurde im Jahre 1963 erstmals im Erprobungspanzer Objekt 432 getestet.
Dabei zeigte sich in einigen Fragen Verbesserungsbedarf. Die schwierige,
sich über viele Jahre hinziehende Entwicklungsarbeit am Projekt T-64 verschaffte
den Konstrukteuren der Zielfernrohre mehr als ausreichend Zeit und so konnte schlussendlich
mit dem TPD-2 ein zuverlässiger Zielfernrohr-Entfernungsmesser
mit integriertem optischen Entfernungsmesser in den nun endlich ab 1969 in
Serie produzierten T-64A eingebaut werden. Auch die ersten T-72
und sogar der erste T-80 waren mit dem TPD-2 ausgestattet. Das TPD-2 berücksichtigte ebenfalls
automatisch die Veränderung
der eingestellten Entfernung bei Bewegung des eigenen Panzers
in Abhängigkeit von Turmstellung und Kurswinkel zum Ziel. Bei Ausfall der
Stromversorgung oder der Messeinrichtung konnte der Richtschütze
ohne Unterbrechnung zum Notbetrieb übergehen. Mit einem
großen horizontalen Einstellring, der sich bereits beim
TPDS und dem T2S bewährt hatte, konnten der Richtschütze,
ohne die Hände von den Richtgriffen zu nehmen und ohne
weitere Schalter bedienen zu müssen, die Schussentfernung
manuell einstellen.
 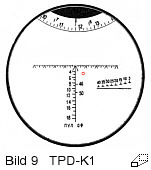 Nachdem
in den späten 60er Jahren international zunehmend Laser-Entfernungsmesser
Eingang in die Ausrüstung der Kampfpanzer fanden, folgte
man auch in der Sowjetunion diesem Trend und so war Mitte der
70er Jahre die Weiterentwicklung des TPD-2 truppenreif. Es handelt
sich um den Zielfernrohr-Entfernungsmesser TPD-K1, der anstelle
des optischen Messteils mit einem Laser-Entfernungsmesser ausgestattet
war. Der Messbereich beträgt 500 bis 4000 Meter bei
einer Messgenauigkeit von 10 Metern, wobei nur Schussentfernungen
bis 3000 Meter von der Entfernungseinstellautomatik berücksichtigt
werden. Im Sichtfeld leuchtet bei Betrieb des Entfernungsmessers
eine rote kreisförmige Messmarkierung auf, die sich nicht
mit der Hauptrichtmarke deckt. Nach dem Messen der Entfernung
und nachfolgend automatisch erfolgter Entfernungseinstellung,
muss der Richtschütze die Hauptrichtmarke manuell auf
das Ziel bringen. Ein ballistischer Rechner für das TPD-K1
war nicht entwickelt worden. Allerdings konnten Korrekturen
für die Abweichungen von den schusstafelmäßigen
Bedingungen manuell eingegeben werden, die spürbaren Einfluss
auf die korrekte Schussentfernung haben, also
Ladungstemperatur, Lufttemperatur, Luftdruckes und
Verringerung der Anfangsgeschwindigkeit infolge Rohrverschleiß.
Diese Werte wurden von einem einfachen analogen Rechenwerk in
eine Korrektur der Schussentfernung umgesetzt. Die seitliche Vorhalte für bewegliche Ziele und den Seitenwind
musste vom Richtschützen selbst ermittelt und berücksichtigt
werden. Die Entwickler hielten diesen Kompromiss gerade noch
für tragfähig, da wegen der hohen Anfangsgeschwindigkeit
der flügelstabilisierten panzerbrechenden Pfeilgeschosse
von 1800 Meter je Sekunde und der geplanten mittleren Einsatzschussentfernung
in Mitteleuropa von 1600 bis 2000 Meter die nötigen Vorhalte
ohnehin nur sehr kleine Werte aufweisen. Später wurde das TPD-K1
mit einem einfachen Rechner kombiniert, der aus der Richtgeschwindigkeit
beim Begleiten beweglicher Ziele wenigstens die Vorhalte in
Abhängigkeit von der Munitionsart und der Schussentfernung
errechnen und in einem
Zusatzokular darstellen konnte. Der abgelesene Wert musste vom
Richtschützen dennoch manuell berücksichtigt werden.
Diese Feuerleitanlage erhielt die Bezeichnung 1A40. In ihrer
modernisierten Version, die erstmals im T-72B eingesetzt wurde,
integrierten die Entwickler zusätzlich einen Windmesser,
dessen Daten bei der Errechnung der Vorhalte ebenfalls Berücksichtigung
fand. Nachdem
in den späten 60er Jahren international zunehmend Laser-Entfernungsmesser
Eingang in die Ausrüstung der Kampfpanzer fanden, folgte
man auch in der Sowjetunion diesem Trend und so war Mitte der
70er Jahre die Weiterentwicklung des TPD-2 truppenreif. Es handelt
sich um den Zielfernrohr-Entfernungsmesser TPD-K1, der anstelle
des optischen Messteils mit einem Laser-Entfernungsmesser ausgestattet
war. Der Messbereich beträgt 500 bis 4000 Meter bei
einer Messgenauigkeit von 10 Metern, wobei nur Schussentfernungen
bis 3000 Meter von der Entfernungseinstellautomatik berücksichtigt
werden. Im Sichtfeld leuchtet bei Betrieb des Entfernungsmessers
eine rote kreisförmige Messmarkierung auf, die sich nicht
mit der Hauptrichtmarke deckt. Nach dem Messen der Entfernung
und nachfolgend automatisch erfolgter Entfernungseinstellung,
muss der Richtschütze die Hauptrichtmarke manuell auf
das Ziel bringen. Ein ballistischer Rechner für das TPD-K1
war nicht entwickelt worden. Allerdings konnten Korrekturen
für die Abweichungen von den schusstafelmäßigen
Bedingungen manuell eingegeben werden, die spürbaren Einfluss
auf die korrekte Schussentfernung haben, also
Ladungstemperatur, Lufttemperatur, Luftdruckes und
Verringerung der Anfangsgeschwindigkeit infolge Rohrverschleiß.
Diese Werte wurden von einem einfachen analogen Rechenwerk in
eine Korrektur der Schussentfernung umgesetzt. Die seitliche Vorhalte für bewegliche Ziele und den Seitenwind
musste vom Richtschützen selbst ermittelt und berücksichtigt
werden. Die Entwickler hielten diesen Kompromiss gerade noch
für tragfähig, da wegen der hohen Anfangsgeschwindigkeit
der flügelstabilisierten panzerbrechenden Pfeilgeschosse
von 1800 Meter je Sekunde und der geplanten mittleren Einsatzschussentfernung
in Mitteleuropa von 1600 bis 2000 Meter die nötigen Vorhalte
ohnehin nur sehr kleine Werte aufweisen. Später wurde das TPD-K1
mit einem einfachen Rechner kombiniert, der aus der Richtgeschwindigkeit
beim Begleiten beweglicher Ziele wenigstens die Vorhalte in
Abhängigkeit von der Munitionsart und der Schussentfernung
errechnen und in einem
Zusatzokular darstellen konnte. Der abgelesene Wert musste vom
Richtschützen dennoch manuell berücksichtigt werden.
Diese Feuerleitanlage erhielt die Bezeichnung 1A40. In ihrer
modernisierten Version, die erstmals im T-72B eingesetzt wurde,
integrierten die Entwickler zusätzlich einen Windmesser,
dessen Daten bei der Errechnung der Vorhalte ebenfalls Berücksichtigung
fand.
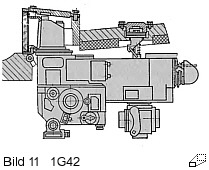 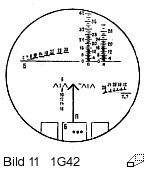 Die
TPD-2 und TPD-K1 wurden zunächst auch in den ersten T-64
und T-80 eingebaut, allerdings in diesen Panzern, nach
relativ kurzer
Zeit, im Jahre 1978 ersetzt durch eine inzwischen zur Serienreife gebrachte
automatische Feuerleitanlage mit elektronischem ballistischen
Rechner und einem Zielfernrohr mit Visierlinienstabilisierung
in zwei Ebenen. Diese Feuerleitanlage 1A33 "Ob" mit
dem Zielfernrohr 1G42 wies bereits nahezu alle Leistungsmerkmale
auf, wie sie ein Jahr später beim deutschen Leopard 2 mit seinem
EMES und der Waffennachführanlage zu finden sind. Die Visierlinienstabilisierung
erfolgt wie schon beim T2S mit Hilfe eines in drei Freiheitsgraden
aufgehängten Kreisels. Dessen Signale gehen mit denen des
kombinierten Turm-
und Waffenkreisel im Kreiselblock unterhalb des Bodenstücks
der Kanone in die Elektronik der Waffennachführanlage ein. Wie
beim Vormuster des 1G42, dem Zielfernrohr 1G21, das offensichtlich
nur in geringer Anzahl gebaut wurde, deckte sich nun die Hauptrichtmarke
mit der Messmarke des Laser-Entfernungsmessers. Der Schütze hat vor dem Schießen
die ballistischen und meteorologischen Abweichungen von den
schusstafelmäßigen Bedingungen am elektronischen
Analogrechner einzugeben. Der Seitenwind wurde durch einen Windmesser
ermittelt. Beim Schießen selbst musste lediglich das Ziel
mit der Hauptrichtmarke abgedeckt und erforderlichenfalls begleitet
und danach die Entfernungsmessung ausgelöst werden.
Nach dem Aufleuchten der Signallampe "Feuerbereit" konnte
sofort geschossen werden. Die Berücksichtigung der korrekten Winkel
für Schussentfernung und seitliche Vorhalte erfolgte mit
Hilfe des ballistischen Rechners und der Waffenstabilisierung
durch das entsprechende Ausschwenken von Turm und Kanone aus
der Visierlinie. Zur Vermeidung von Fehlmessung bei der Entfernungsbestimmung
war
es möglich unter drei Messergebnissen auszuwählen
und zusätzlich den Messbereich bei störenden Geländehindernissen
zu limitieren. Ensprechend der sowjetischen Bedienungsphilosophie war auch das 1G42 für
den unverzüglichen Übergang
zum Schießen im Notbetrieb geeignet. Erstmals besaß
das 1G42 eine im Bereich 3,5 bis 9-fach stufenlos veränderbare
Vergrößerung, nachdem sich die feste 8-fache Vergrößerung
des TPD-K1 bei großen Schussentfernungen als unbefriedigend
erwiesen hatte. Das modular aufgebaute
1G42 war bei den T-64B und T-80B mit der Lenkwaffenanlage
9K112 KOBRA kombiniert. Die aus verschiedensten Gründen begrenzten
Produktionskapazitäten des Herstellers erlaubten es allerdings
nicht,
alle sowjetischen Kampfpanzer mit der damals hochmodernen Feuerleitanlage 1A33 und
dem Zielfernrohr 1G42 auszustatten, so dass für den Hersteller
des T-72 auschließlich das einfachere Zielfernrohr TPD-K1
bereit gestellt werden konnte. Die
TPD-2 und TPD-K1 wurden zunächst auch in den ersten T-64
und T-80 eingebaut, allerdings in diesen Panzern, nach
relativ kurzer
Zeit, im Jahre 1978 ersetzt durch eine inzwischen zur Serienreife gebrachte
automatische Feuerleitanlage mit elektronischem ballistischen
Rechner und einem Zielfernrohr mit Visierlinienstabilisierung
in zwei Ebenen. Diese Feuerleitanlage 1A33 "Ob" mit
dem Zielfernrohr 1G42 wies bereits nahezu alle Leistungsmerkmale
auf, wie sie ein Jahr später beim deutschen Leopard 2 mit seinem
EMES und der Waffennachführanlage zu finden sind. Die Visierlinienstabilisierung
erfolgt wie schon beim T2S mit Hilfe eines in drei Freiheitsgraden
aufgehängten Kreisels. Dessen Signale gehen mit denen des
kombinierten Turm-
und Waffenkreisel im Kreiselblock unterhalb des Bodenstücks
der Kanone in die Elektronik der Waffennachführanlage ein. Wie
beim Vormuster des 1G42, dem Zielfernrohr 1G21, das offensichtlich
nur in geringer Anzahl gebaut wurde, deckte sich nun die Hauptrichtmarke
mit der Messmarke des Laser-Entfernungsmessers. Der Schütze hat vor dem Schießen
die ballistischen und meteorologischen Abweichungen von den
schusstafelmäßigen Bedingungen am elektronischen
Analogrechner einzugeben. Der Seitenwind wurde durch einen Windmesser
ermittelt. Beim Schießen selbst musste lediglich das Ziel
mit der Hauptrichtmarke abgedeckt und erforderlichenfalls begleitet
und danach die Entfernungsmessung ausgelöst werden.
Nach dem Aufleuchten der Signallampe "Feuerbereit" konnte
sofort geschossen werden. Die Berücksichtigung der korrekten Winkel
für Schussentfernung und seitliche Vorhalte erfolgte mit
Hilfe des ballistischen Rechners und der Waffenstabilisierung
durch das entsprechende Ausschwenken von Turm und Kanone aus
der Visierlinie. Zur Vermeidung von Fehlmessung bei der Entfernungsbestimmung
war
es möglich unter drei Messergebnissen auszuwählen
und zusätzlich den Messbereich bei störenden Geländehindernissen
zu limitieren. Ensprechend der sowjetischen Bedienungsphilosophie war auch das 1G42 für
den unverzüglichen Übergang
zum Schießen im Notbetrieb geeignet. Erstmals besaß
das 1G42 eine im Bereich 3,5 bis 9-fach stufenlos veränderbare
Vergrößerung, nachdem sich die feste 8-fache Vergrößerung
des TPD-K1 bei großen Schussentfernungen als unbefriedigend
erwiesen hatte. Das modular aufgebaute
1G42 war bei den T-64B und T-80B mit der Lenkwaffenanlage
9K112 KOBRA kombiniert. Die aus verschiedensten Gründen begrenzten
Produktionskapazitäten des Herstellers erlaubten es allerdings
nicht,
alle sowjetischen Kampfpanzer mit der damals hochmodernen Feuerleitanlage 1A33 und
dem Zielfernrohr 1G42 auszustatten, so dass für den Hersteller
des T-72 auschließlich das einfachere Zielfernrohr TPD-K1
bereit gestellt werden konnte.
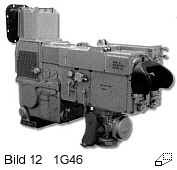 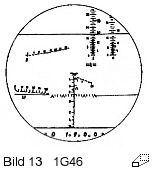 Anfang
der 80er Jahre flossen die Erfahrungen mit dem 1G42 in die Entwicklung
des Nachfolgemodells 1G46 ein, das 1983 erstmals in den T-80U
eingebaut wurde. Das Grundprinzip des 1G46 entsprach dabei im
wesentlichen immer noch dem T2S der 50er Jahre. Die Zuverlässigkeit
der mechanischen Visierlinienstabilisierung mit einem Kreisel
großen Durchmessers muss sich so überragend bewährt
haben, dass die Entwickler dem internationalen Trend der Elektronisierung
offenbar zunächst nicht folgen wollten. Erfahrungen mit
dem deutschen EMES zeigten beispielsweise eine deutliche Neigung
der Feinmechanik einer elektromechanischen Visierlinienstabilisierung zum Ausfall
nach längerfristiger Nichtbenutzung, was bei den
sowjetischen Zielfernrohren kaum Probleme verursachte. Große
Anstrengungen legten die Konstrukteure allerdings auf die Vervollkommnung
und Verfeinerung der Waffenstabilisierungsanlage. Hier hatte sich gezeigt,
dass die ausgezeichnete Stabilisierungsgüte der Visierlinienstabilisierung
im Zielfernrohr nicht mit der Güte der Waffennachführung
korrespondierte, was auch die immer wieder verbesserte Koinzidenzprüfung
der Schussauslösung nicht vollständig kompensieren
konnte. Im Ergebnis entsprach die Treffaussicht nicht ganz den
beachtenswerten Ergebnissen, die beispielsweise mit dem Leopard 2 erreicht
wurden. Mit dem 1G46, der modernisierten Feuerleitanlage 1A45
und der vervollkommneten Waffenstabilisierung 2E42 ergaben sich dann Leistungsdaten, die im
Bereich internationaler
Bestwerte liegen. Fest in das 1G46 integriert ist die Laser-Leitstrahleinrichtung
der Lenkwaffenanlage 9M119 REFLEKS. Die stufenlos einstellbare
Vergrößerung deckt nun den Bereich vom 2,7-fachen
bis 12-fachen ab und enspricht optimal der gestiegenen Leistungsfähigkeit
der 125 mm Kanone 2A46M sowie der verbesserten Munition.
Das 1G46 wird bisher in den russischen T-80U, T-80UM, T-90,
sowie die ukrainischen T-64BM und T-84 OPLOT eingebaut. Anfang
der 80er Jahre flossen die Erfahrungen mit dem 1G42 in die Entwicklung
des Nachfolgemodells 1G46 ein, das 1983 erstmals in den T-80U
eingebaut wurde. Das Grundprinzip des 1G46 entsprach dabei im
wesentlichen immer noch dem T2S der 50er Jahre. Die Zuverlässigkeit
der mechanischen Visierlinienstabilisierung mit einem Kreisel
großen Durchmessers muss sich so überragend bewährt
haben, dass die Entwickler dem internationalen Trend der Elektronisierung
offenbar zunächst nicht folgen wollten. Erfahrungen mit
dem deutschen EMES zeigten beispielsweise eine deutliche Neigung
der Feinmechanik einer elektromechanischen Visierlinienstabilisierung zum Ausfall
nach längerfristiger Nichtbenutzung, was bei den
sowjetischen Zielfernrohren kaum Probleme verursachte. Große
Anstrengungen legten die Konstrukteure allerdings auf die Vervollkommnung
und Verfeinerung der Waffenstabilisierungsanlage. Hier hatte sich gezeigt,
dass die ausgezeichnete Stabilisierungsgüte der Visierlinienstabilisierung
im Zielfernrohr nicht mit der Güte der Waffennachführung
korrespondierte, was auch die immer wieder verbesserte Koinzidenzprüfung
der Schussauslösung nicht vollständig kompensieren
konnte. Im Ergebnis entsprach die Treffaussicht nicht ganz den
beachtenswerten Ergebnissen, die beispielsweise mit dem Leopard 2 erreicht
wurden. Mit dem 1G46, der modernisierten Feuerleitanlage 1A45
und der vervollkommneten Waffenstabilisierung 2E42 ergaben sich dann Leistungsdaten, die im
Bereich internationaler
Bestwerte liegen. Fest in das 1G46 integriert ist die Laser-Leitstrahleinrichtung
der Lenkwaffenanlage 9M119 REFLEKS. Die stufenlos einstellbare
Vergrößerung deckt nun den Bereich vom 2,7-fachen
bis 12-fachen ab und enspricht optimal der gestiegenen Leistungsfähigkeit
der 125 mm Kanone 2A46M sowie der verbesserten Munition.
Das 1G46 wird bisher in den russischen T-80U, T-80UM, T-90,
sowie die ukrainischen T-64BM und T-84 OPLOT eingebaut.
Während die modernen sowjetischen Kampfpanzer
mit leistungsfähigen Zielfernrohren und entsprechenden
Feuerleitanlagen ausgestattet wurden, befand sich immer noch
eine sehr große Anzahl veralteter T-55 und T-62 im aktiven
Truppendienst. Um ihre Dienstzeit nochmals verlängern zu
können, nahmen die sowjetischen Entwickler die Idee der
Visierlinienstabilisierung nach dem Prinzip des TOS aus dem
Jahre 1938 wieder auf und kombinierten das Teleskopzielfernrohr
TSh2B mit einer einfachen 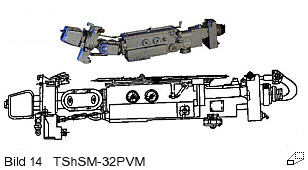 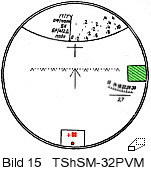 Visierlinienstabilisierung. Ein oft
angesprochener Mangel
das TSh2 war der Umstand, dass während des Ladevorganges
die Kanone nicht stabilisiert wurde und der Richtschütze
in der Folge das Ziel aus den Augen verlor. Beim TShS übernahm
nun eine Kreiseleinrichtung im Zielfernrohr während der
Zeit, in der die Kanone nicht stabilisiert wurde, die Aufgabe
der Visierlinienstabilisierung. Die optischen Kennwerte des
TShS entsprachen dabei denen des TSh2B. Die Entfernungsskalen
befinden sich nun als Drehscheibe im oberen Teil des Sichtfeldes
und enthalten die Skalen für die Kanonenmunition und das
Koaxial-Maschinengewehr. Die Entfernungsmessung übernimmt
ein außen auf der Walzenblende angebrachter Laser-Entfernungsmesser.
Eine einfache Einrichtung misst die Winkelgeschwindigkeit während
der Begleitung beweglicher Ziele durch den Richtschützen
und zeigt im Sichtfeld des TShS die korrekte Vorhaltemarke an,
die anschließend manuell auf das Ziel zu bringen ist.
Das TShS wurde Anfang der 80er Jahre zum TShSM modernisiert
und mit einem leistungsfähigeren ballistischen elektronischen
Rechner kombiniert. Visierlinienstabilisierung. Ein oft
angesprochener Mangel
das TSh2 war der Umstand, dass während des Ladevorganges
die Kanone nicht stabilisiert wurde und der Richtschütze
in der Folge das Ziel aus den Augen verlor. Beim TShS übernahm
nun eine Kreiseleinrichtung im Zielfernrohr während der
Zeit, in der die Kanone nicht stabilisiert wurde, die Aufgabe
der Visierlinienstabilisierung. Die optischen Kennwerte des
TShS entsprachen dabei denen des TSh2B. Die Entfernungsskalen
befinden sich nun als Drehscheibe im oberen Teil des Sichtfeldes
und enthalten die Skalen für die Kanonenmunition und das
Koaxial-Maschinengewehr. Die Entfernungsmessung übernimmt
ein außen auf der Walzenblende angebrachter Laser-Entfernungsmesser.
Eine einfache Einrichtung misst die Winkelgeschwindigkeit während
der Begleitung beweglicher Ziele durch den Richtschützen
und zeigt im Sichtfeld des TShS die korrekte Vorhaltemarke an,
die anschließend manuell auf das Ziel zu bringen ist.
Das TShS wurde Anfang der 80er Jahre zum TShSM modernisiert
und mit einem leistungsfähigeren ballistischen elektronischen
Rechner kombiniert.
Während die T-80U, T-64BM und T-90 mit
dem Zielfernrohr 1G46 ausgestattet waren, entsprach das TPD-K1
des T-72 längst nicht mehr den Leistungsanforderungen für
ein modernes Zielfernrohr. Ende der 90er Jahre wurde ein modernisierter
T-72 vorgestellt, der nun mit dem weissrussischen SOSNA-U der
Firma PELENG ein Mehrkanalzielfernrohr neuster Generation erhalten
hatte. Das SOSNA-U umfasst in einem einzigen Gehäuse den
Tagkanal und Wärmebildkanal des Zielfernrohrs, einen Laser-Entfernungsmesser
und die Laser-Leitstrahleinrichtung für die Steuerung von
aus dem Rohr der Kanone verschossenen   Lenkflugkörpern
9M119M INVAR. Die elektronisch elektromechanische Visierlinienstabilisierung
arbeitet in der vertikalen und der horizontalen Ebene unabhängig
von der Waffenstabilisierung. Ein digitaler ballistischer Rechner
stellt die erforderlichen Daten für das Schießen
mit höchster Präzision bereit. Das SOSNA-U kann mit
einer automatischen Zielbegleitung, dem sogenannten "auto tracking",
ausgestattet werden. Die Elektronik der
Wärmebildkamera erlaubt die Übertragung des Wärmebildes
auf einen Monitor am Arbeitsplatz des Kommandanten. Vom Kommandantenplatz kann
dann, über einen separaten Richtgriff gesteuert, die Führung
der Hauptbewaffnung übernommen werden. Neu ist am SOSNA-U,
dass der Notbetrieb, wie noch beim 1G46, bei Ausfall der Stromversorgung
nicht mehr möglich ist. Um dennoch die geforderte Redundanz
zu gewährleisten, ist ein weiteres unabhängiges Zielfernrohr
erforderlich. Dies könnte ein Rundblickzielfernrohr am
Kommandantenplatz sein, das die Möglichkeit zum Schießen
mit der Turmbewaffnung bietet. Beim T-72M1M entschieden sich
die Konstrukteure jedoch dazu, das SOSNA-U anstelle des bisherigen
Infrarot-Nachtzielfernrohres TPN-1 bzw. TPN-3 in der Turmdecke
einzubauen. Das vormalige Hauptzielfernrohr TPD-K1 übernimmt
dabei die Rolle des Hilfszielfernrohres. Dass man sich nicht
entschloss, auf das TPD-K1 völlig zu verzichten und das
SOSNA-U, ergänzt um ein sehr einfaches Hilfszielfernrohr,
an seiner Stelle einzubauen, erscheint allerdings inkonsequent. Lenkflugkörpern
9M119M INVAR. Die elektronisch elektromechanische Visierlinienstabilisierung
arbeitet in der vertikalen und der horizontalen Ebene unabhängig
von der Waffenstabilisierung. Ein digitaler ballistischer Rechner
stellt die erforderlichen Daten für das Schießen
mit höchster Präzision bereit. Das SOSNA-U kann mit
einer automatischen Zielbegleitung, dem sogenannten "auto tracking",
ausgestattet werden. Die Elektronik der
Wärmebildkamera erlaubt die Übertragung des Wärmebildes
auf einen Monitor am Arbeitsplatz des Kommandanten. Vom Kommandantenplatz kann
dann, über einen separaten Richtgriff gesteuert, die Führung
der Hauptbewaffnung übernommen werden. Neu ist am SOSNA-U,
dass der Notbetrieb, wie noch beim 1G46, bei Ausfall der Stromversorgung
nicht mehr möglich ist. Um dennoch die geforderte Redundanz
zu gewährleisten, ist ein weiteres unabhängiges Zielfernrohr
erforderlich. Dies könnte ein Rundblickzielfernrohr am
Kommandantenplatz sein, das die Möglichkeit zum Schießen
mit der Turmbewaffnung bietet. Beim T-72M1M entschieden sich
die Konstrukteure jedoch dazu, das SOSNA-U anstelle des bisherigen
Infrarot-Nachtzielfernrohres TPN-1 bzw. TPN-3 in der Turmdecke
einzubauen. Das vormalige Hauptzielfernrohr TPD-K1 übernimmt
dabei die Rolle des Hilfszielfernrohres. Dass man sich nicht
entschloss, auf das TPD-K1 völlig zu verzichten und das
SOSNA-U, ergänzt um ein sehr einfaches Hilfszielfernrohr,
an seiner Stelle einzubauen, erscheint allerdings inkonsequent.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und
dem Ende des Kalten Krieges hatten sich den Entwicklern, unter
den Bedingungen des harten Konkurrenzkampfes am Markt, völlig
neue
Möglichkeiten eröffnet. Es wurden hochmoderne Zielfernrohre
neuster Konstruktion hergestellt, die international auf höchstem
Niveau stehen. Die führenden Technologiezentren für
moderne Zielfernrohre befinden sich gegenwärtig in erster
Linie im weissrussischen Unternehmen PELENG in Minsk und dem
russischen Konstruktionsbüro KBP in Tula. Ihre Zielfernrohre
werden in die BMP-3, BMD-4, T-90S und weitere Gefechtsfahrzeuge
eingebaut und erfolgreich exportiert. Der T-90S ist noch immer
mit dem inzwischen recht betagten 1G46 ausgestattet. Sein Nachfolger
wird dagegen über eine Feuerleitausstattung neuerer Generation
verfügen. Auch wenn das Erscheinen des geheimnisumwitterten
"T-95" in der Vergangenheit mehrfach angekündigt
wurde, ist gegenwärtig noch nicht absehbar, ob und wann
ein Nachfolger des T-90 überhaupt in einer größeren
Serie hergestellt werden wird.
Teil 1
Teil 2 Tabellen,
Bildquellen, Literatur
|