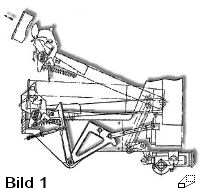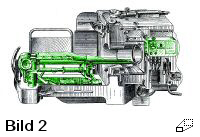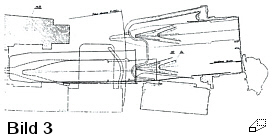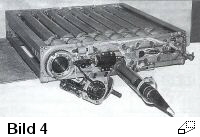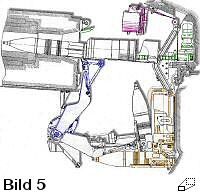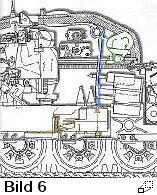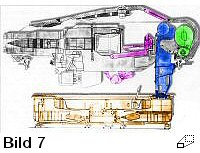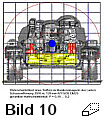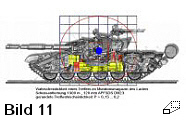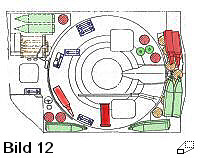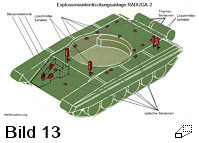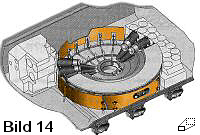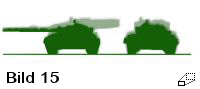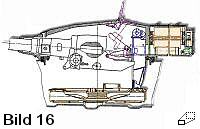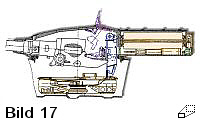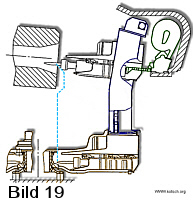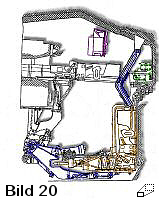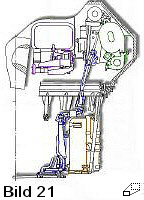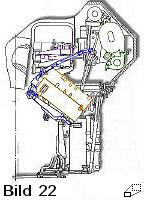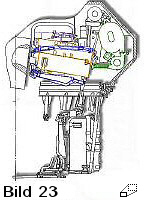|

|
Vom
T-10 bis zum T-95 - Entwicklung und Perspektiven
automatischer Ladeeinrichtungen
für russische Kampfpanzer
Der Artikel unterliegt der weiteren Fortschreibung. Stand
24.11.2009
Das
Bestreben den Ladevorgang im Kampfpanzer zu beschleunigen, führte
bereits im 2. Weltkrieg zu Überlegungen, eine einfache
mechanische Ladehilfe für den deutschen Panzer PANTHER zu
entwickeln. Diese Ladeeinrichtung bestand im Wesentlichen aus
einer mechanischen Ladeschale mit einem Ansetzer, der seine
Energie aus dem Rücklauf der Kanone bezog. Zum Einsatz
kam der mit dieser Ladeeinrichtung augestattete Panzer nicht
mehr. In Frankreich begann Ende der 40er Jahre die Produktion
des leichten Panzers
AMX-13, der international erstmalig serienmäßig
mit einer mechanischen Ladeeinrichtung ausgestattet war. Diese
Ladeeinrichtung umfasste zwei Munitionstrommeln im Turmheck,
die manuell angetrieben werden mussten, während der Ansetzer
wie beim beschriebenen Modell des PANTHER seine Energie aus
dem Rücklauf der Kanone bezog. Die beschossenen Patronenhülsen
wurden nach außen aus dem Turm ausgeworfen. In der UdSSR
waren in der selben Zeit die Konstruktionsbüros auf dem
Weg,
den zukünftigen Standardkampfpanzer der sowjetischen Panzertruppe
zu entwerfen, der, technologisch aufwändig, zu einer völlig neuen Panzergeneration
führen sollte. Ohne Zweifel flossen die deutschen und französischen
Erfahrungen in die Überlegungen der sowjetischen Entwickler ein.
Mitte
der 50er Jahre 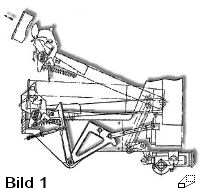 arbeitete das Entwicklerteam von URALVAGONZAVOD am Projekt Objekt 165,
einem Kampfpanzer mit der gezogenen 100 mm Kanone D-54,
deren Patronen eine Länge erreichten, die ihre
Handhabung
im begrenzten Innenraum des Turms
deutlich erschwerte. Um dem Ladeschützen die Arbeit zu erleichtern,
hatten die Ingenieure eine Hülsenauswurfeinrichtung (Bild
1) entworfen.
Die beschossene Patronenhülse wurde durch eine an einem
schwenkbaren Rahmen befestigte Fangeinrichtung erfasst und anschließend
durch eine Luke im Turmheck ausgeworfen. Im Ergebnis behinderten
den Ladeschützen keine auf dem Turmkorbboden liegenden
Hülsen und darüber hinaus sank die Belastung der Besatzung
durch aus den Hülsen austretende Pulvergase. Diese Hülsenauswurfeinrichtung
findet sich später im T-62 wieder, der in den 60er und
70er Jahren in einer großen Anzahl in Serie produziert
wurde. Das
Konstruktionsbüro im WERK Nr. 9 in Ekaterienburg,
einem nahmhaften Kanonenhersteller, entwarf
in dieser Zeit verschiedene Modelle von Panzerkanonen arbeitete das Entwicklerteam von URALVAGONZAVOD am Projekt Objekt 165,
einem Kampfpanzer mit der gezogenen 100 mm Kanone D-54,
deren Patronen eine Länge erreichten, die ihre
Handhabung
im begrenzten Innenraum des Turms
deutlich erschwerte. Um dem Ladeschützen die Arbeit zu erleichtern,
hatten die Ingenieure eine Hülsenauswurfeinrichtung (Bild
1) entworfen.
Die beschossene Patronenhülse wurde durch eine an einem
schwenkbaren Rahmen befestigte Fangeinrichtung erfasst und anschließend
durch eine Luke im Turmheck ausgeworfen. Im Ergebnis behinderten
den Ladeschützen keine auf dem Turmkorbboden liegenden
Hülsen und darüber hinaus sank die Belastung der Besatzung
durch aus den Hülsen austretende Pulvergase. Diese Hülsenauswurfeinrichtung
findet sich später im T-62 wieder, der in den 60er und
70er Jahren in einer großen Anzahl in Serie produziert
wurde. Das
Konstruktionsbüro im WERK Nr. 9 in Ekaterienburg,
einem nahmhaften Kanonenhersteller, entwarf
in dieser Zeit verschiedene Modelle von Panzerkanonen 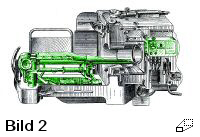 der
Kaliber 100 bis 122 mm. So auch für einen Prototypen
an dem in Charkov gearbeitet wurde, der später in den
Prototypen Objekt 430 / T-64 mündete und
als künftiger
sowjetischer Standardkampfpanzer vorgesehen war. Die gezogene
100 mm Kanone D-46T, die ab 1949 entwickelt wurde, war bereits
mit einem elektromechanischen Kettenansetzer ausgestattet.
Eine ähnliche Einrichtung (Bild 2) befindet sich auch im schweren
Panzer T-10M von 1957. Immer wieder war die zu geringe
Feuergeschwindigkeit der 122 mm Kanone bemängelt worden,
deren geteilte Munition bisher von Hand zu laden war. Mit der
neuen Ansetzereinrichtung konnte die Arbeit des Ladeschützen
erheblich vereinfacht und die Feuergeschwindigkeit deutlich
erhöht werden. Die Einrichtung besteht aus einer horizontal
beweglichen Ladeschale mit einem elektromechanischen Kettenansetzer.
Der Ladeschütze hatte nacheinander Geschoss und Treibladungshülse
auf die Ladeschale zu legen, sie von Hand seitlich in die Zuführlinie
zu schieben und dann den elektromechanischen Kettenansetzer auszulösen. der
Kaliber 100 bis 122 mm. So auch für einen Prototypen
an dem in Charkov gearbeitet wurde, der später in den
Prototypen Objekt 430 / T-64 mündete und
als künftiger
sowjetischer Standardkampfpanzer vorgesehen war. Die gezogene
100 mm Kanone D-46T, die ab 1949 entwickelt wurde, war bereits
mit einem elektromechanischen Kettenansetzer ausgestattet.
Eine ähnliche Einrichtung (Bild 2) befindet sich auch im schweren
Panzer T-10M von 1957. Immer wieder war die zu geringe
Feuergeschwindigkeit der 122 mm Kanone bemängelt worden,
deren geteilte Munition bisher von Hand zu laden war. Mit der
neuen Ansetzereinrichtung konnte die Arbeit des Ladeschützen
erheblich vereinfacht und die Feuergeschwindigkeit deutlich
erhöht werden. Die Einrichtung besteht aus einer horizontal
beweglichen Ladeschale mit einem elektromechanischen Kettenansetzer.
Der Ladeschütze hatte nacheinander Geschoss und Treibladungshülse
auf die Ladeschale zu legen, sie von Hand seitlich in die Zuführlinie
zu schieben und dann den elektromechanischen Kettenansetzer auszulösen.
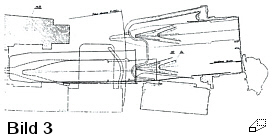 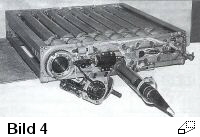 Die
vermutlich erste sowjetische Ladeeinrichtung, die den vollständigen
Ladevorgang mechanisierte, war die Ladeeinrichtung (Bild 3)
für
den Prototyp eines schweren Panzers unter der Bezeichnung Objekt 279
aus dem Jahre 1957. Die Entwickler hatten sich entschlossen,
das Munitionsmagazin der Ladeeinrichtung für die gezogenen
130 mm Kanone im Turmheck unterzubringen. Einen sogenannten
Bandlader im Turmheck (Bild 4) sah man Anfang der 60er Jahre auch für
einen Prototypen eines leichten Panzer auf Basis des Schwimmpanzers PT-67 vor.
Diese Ladeeinrichtung wies bereits alle Merkmale der heutigen
modernen Bandlader auf, wie elektrischer Haupt- und manueller
Notantrieb, Ladeschale, umlaufendes Band mit Munitionskassetten
usw.. Die
vermutlich erste sowjetische Ladeeinrichtung, die den vollständigen
Ladevorgang mechanisierte, war die Ladeeinrichtung (Bild 3)
für
den Prototyp eines schweren Panzers unter der Bezeichnung Objekt 279
aus dem Jahre 1957. Die Entwickler hatten sich entschlossen,
das Munitionsmagazin der Ladeeinrichtung für die gezogenen
130 mm Kanone im Turmheck unterzubringen. Einen sogenannten
Bandlader im Turmheck (Bild 4) sah man Anfang der 60er Jahre auch für
einen Prototypen eines leichten Panzer auf Basis des Schwimmpanzers PT-67 vor.
Diese Ladeeinrichtung wies bereits alle Merkmale der heutigen
modernen Bandlader auf, wie elektrischer Haupt- und manueller
Notantrieb, Ladeschale, umlaufendes Band mit Munitionskassetten
usw..
Unter den Fachleuten wurden damals mögliche
Grundkonzeptionen
von automatischen Ladeeinrichtungen diskutiert. Letztlich
entschlossen sich die sowjetischen Konstrukteure, den Ladeeinrichtungen
mit konstantem Ladewinkel bei Unterbringung des Munitionsmagazins
in der Wanne 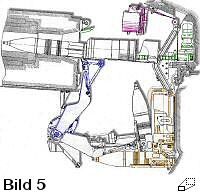 unter
dem Turm den Vorrang zu geben. Auschlaggebend mag gewesen sein,
dass die Leistung der verfügbaren Panzermotoren die Gesamtmasse
der Panzerung streng limitierte. Außerdem führt
die Unterbringung des Munitionsmagazins im Turmheck zu einer
deutlichen Vergrößerung der Turmsilhouette, was die
Wahrscheinlichkeit von Treffern im Turm erhöht. Die Sicherheit der
Panzerbesatzung stand offensichtlich noch nicht an erster Stelle
der Bewertungskriterien.. Allerdings erhöhte der Einbau
einer automatischen Ladeeinrichtung bei vorgegebener Motorleistung
die Gewichtsreserve für die Gestaltung einer ausreichend
widerstandfähigen Panzerung. Dazu trug auch der konsequente
Leichtbau der meisten Baugruppen und Teile im Panzer bei. Beispielsweise
verfügte der deutsche Kampfpanzer LEOPARD 1 über
eine maximale Panzerungsdicke von nur 70 mm, weil das Gewicht
der Baugruppen im Panzer in Verbindung mit der Leistung des
830 PS Dieselmotors eine weitere Verstärkung der Panzerung
nicht mehr zuließ. unter
dem Turm den Vorrang zu geben. Auschlaggebend mag gewesen sein,
dass die Leistung der verfügbaren Panzermotoren die Gesamtmasse
der Panzerung streng limitierte. Außerdem führt
die Unterbringung des Munitionsmagazins im Turmheck zu einer
deutlichen Vergrößerung der Turmsilhouette, was die
Wahrscheinlichkeit von Treffern im Turm erhöht. Die Sicherheit der
Panzerbesatzung stand offensichtlich noch nicht an erster Stelle
der Bewertungskriterien.. Allerdings erhöhte der Einbau
einer automatischen Ladeeinrichtung bei vorgegebener Motorleistung
die Gewichtsreserve für die Gestaltung einer ausreichend
widerstandfähigen Panzerung. Dazu trug auch der konsequente
Leichtbau der meisten Baugruppen und Teile im Panzer bei. Beispielsweise
verfügte der deutsche Kampfpanzer LEOPARD 1 über
eine maximale Panzerungsdicke von nur 70 mm, weil das Gewicht
der Baugruppen im Panzer in Verbindung mit der Leistung des
830 PS Dieselmotors eine weitere Verstärkung der Panzerung
nicht mehr zuließ.
Die Entwicklerteams in Charkov
und in Nizhniy Tagil, die sich vorrangig mit der Konstruktion
mittlerer Kampfpanzer beschäftigten, begannen ihre Arbeiten
an den zukünftigen Kampfpanzern. Insbesondere Morozovs
Team in Charkov hatte sich der Schaffung eines völlig neuen
Standardpanzers neuer Generation verschrieben, dem späteren
T-64. Nach ersten Schritten mit einer vierköpfigen Besatzung
schwenkte man in eine andere Richtung um und entwarf für
den Prototypen Objekt 432 mit drei Besatzungsmitgliedern
eine automatische Ladeeinrichtung (Bild 5). Das Magazin wurde in der
Wanne unter dem Turmdrehkranz untergebracht und nahm für
die 115 mm Glattrohrkanone 30 geteilte, mit einem
Scharnier verbundene Munitionskassetten auf, die in L-Form um
den Turmkorb aufgehängt waren. Als später die 125 mm
Kanone 2A26 eingebaut wurde, verringerte sich das Fassungsvermögen
auf 28 Kassetten. Ein Nachteil dieser Kassettenanordnung ist
die Isolation des 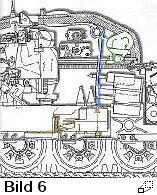 Fahrerplatzes
von den Besatzungsmitgliedern im Turm, so dass ein Übergang in den Turm nur nach Herausnahme
von 2 bis 3 Kassetten aus dem Kassettentragring möglich
wurde. Um unter den Bedingungen des Einsatzes von ABC-Waffen die
Enthermetisierung des Kampfraumes zu vermeiden, verzichtete
man auf das Auswerfen der Hülse durch eine Luke im Turmheck.
Die Hülse wurde im Verlaufe des Ladevorganges in die frei
gewordene Munitionskassette abgelegt und verblieb im Panzer. Fahrerplatzes
von den Besatzungsmitgliedern im Turm, so dass ein Übergang in den Turm nur nach Herausnahme
von 2 bis 3 Kassetten aus dem Kassettentragring möglich
wurde. Um unter den Bedingungen des Einsatzes von ABC-Waffen die
Enthermetisierung des Kampfraumes zu vermeiden, verzichtete
man auf das Auswerfen der Hülse durch eine Luke im Turmheck.
Die Hülse wurde im Verlaufe des Ladevorganges in die frei
gewordene Munitionskassette abgelegt und verblieb im Panzer.
Nahezu
zeitgleich zu ihren Charkover Kollegen entwarfen die Entwickler
des Konstruktionsbüros von URALVAGONZAVOD eine automatische
Ladeeinrichtung (Bild 6) für das Projekt Objekt 167M T-62. Sie unterschied
sich vom Charkover Modell in erster Linie durch die Anordnung
der Kassetten, die horizontal auf dem Wannenboden in einen Tragstern
eingesetzt waren. Geschoss und Treibladung lagen in einer gemeinsamen
Kassette vertikal übereinander. Anders als beim späteren
T-64, bei dem die Teilsysteme der Ladeeinrichtung ausschließlich
elektrohydraulisch angetrieben wurden, setzten die Ingenieure
in Nizhniy Tagil auf elektromechanische Antriebe. Diese Ladeeinrichtung
wurde weiter verbessert und kam später im T-72 (Bild 7)
zum Einsatz.
Beide Varianten
haben ihre Vor und Nachteile. Die unvermeidliche Menge Hydraulikflüssigkeit
beim T-64 erhöht die Explosionsgefahr bei Treffern und
nachfolgendem Austreten von Hydrauliköl, Andererseits kann ein Hydraulikmotor
ein größeres 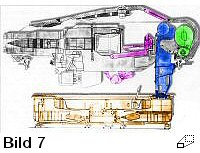 Drehmoment
aufbringen. So hatten Panzerbesatzungen von T-72 berichtet,
bei schrägstehendem Panzer im Gebirge habe der Elektromotor
zeitweise das halbentleerte, unwuchtige Magazin nicht mehr drehen
können. Später wurde deshalb der Elektromotor und
das Untersetzungsgetriebe verändert. Die Unterschiede im
Zeitaufwand für einen vollständigen Ladezyklus liegen
im Bereich von 2 bis maximal 3 Sekunden und können bei
praktikablen Feuergeschwindigkeiten unter Gefechtsbedingungen
von etwa 7 bis 10 Sekunden je Schuss durchaus vernachlässigt
werden. Zwei Mängel haben jedoch beide Ladeeinrichtungen
gemeinsam. Zum ersten befindet sich die Munition, und hier
vor allem die Treibladungen mit ihren teilweise verbrennenden
Hülsen, zusammen mit der Besatzung im Kampfraum. Eine Entzündung
der nicht isolierten Munition kann zu einer Explosion im Kampfraum
mit fatalen Folgen für die Besatzung und zur vollständige
Zerstörung des Panzers führen. Diese Gefahr ist den
Entwicklern durchaus klar gewesen. Man ging allerdings davon
aus, dass die Unterbringung des Munitionsmagazins unter
dem Turm am tiefsten Punkt des Panzers auf dem Wannenboden die Wahrscheinlichkeit
eines Treffers im Magazin (in den Skizzen Gelb gekennzeichnet)
relativ gering halten würde. Drehmoment
aufbringen. So hatten Panzerbesatzungen von T-72 berichtet,
bei schrägstehendem Panzer im Gebirge habe der Elektromotor
zeitweise das halbentleerte, unwuchtige Magazin nicht mehr drehen
können. Später wurde deshalb der Elektromotor und
das Untersetzungsgetriebe verändert. Die Unterschiede im
Zeitaufwand für einen vollständigen Ladezyklus liegen
im Bereich von 2 bis maximal 3 Sekunden und können bei
praktikablen Feuergeschwindigkeiten unter Gefechtsbedingungen
von etwa 7 bis 10 Sekunden je Schuss durchaus vernachlässigt
werden. Zwei Mängel haben jedoch beide Ladeeinrichtungen
gemeinsam. Zum ersten befindet sich die Munition, und hier
vor allem die Treibladungen mit ihren teilweise verbrennenden
Hülsen, zusammen mit der Besatzung im Kampfraum. Eine Entzündung
der nicht isolierten Munition kann zu einer Explosion im Kampfraum
mit fatalen Folgen für die Besatzung und zur vollständige
Zerstörung des Panzers führen. Diese Gefahr ist den
Entwicklern durchaus klar gewesen. Man ging allerdings davon
aus, dass die Unterbringung des Munitionsmagazins unter
dem Turm am tiefsten Punkt des Panzers auf dem Wannenboden die Wahrscheinlichkeit
eines Treffers im Magazin (in den Skizzen Gelb gekennzeichnet)
relativ gering halten würde.


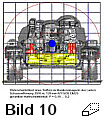
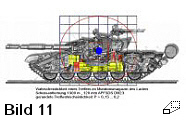
Eine überschlagsweise Betrachtung der Treffwahrscheinlichkeit
mit der deutschen 120 mm Kanone des LEOPARD 2 zeigt,
dass bei einer mittleren Schussentfernung von 1500 m das Magazin
nur mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit getroffen
wird, wenn davon ausgegangen wird, dass die Wanne in jedem Fall
durchschlagen wird (Bilder 8 und 9). Mit zunehmender Schussentfernung (Bilder 10
und 11) steigt
zwar die Wahrscheinlichkeit eines Treffers im Munitionsmagazin
durch Aufweitung des Streukreises,
gleichzeitig sinkt aber auch die Durchschlagsleistung der APFSDS-Geschosse.
Moderne Geschosse weisen eine erheblich geringerer
Streuung als das Referenzgeschoss DM 23 auf, wodurch bei
Haltepunkt Zielmitte 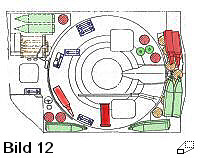 die Wahrscheinlichkeit eines Treffers im
unteren Wannenbereich weiter sinkt. die Wahrscheinlichkeit eines Treffers im
unteren Wannenbereich weiter sinkt.
Wegen des beschränkten
Fassungsvermögens des Magazins ist ein Teil der Munition
in Halterungen in der Wanne untergebracht. Eine
große Anzahl der Treibladungen wird dabei in den kombinierten
Diesel-Munitionsgestellen im Bug und an der Motortrennwand untergebracht
und ist dadurch in gewisser Weise vor direkter Brandeinwirkung geschützt
(in den Skizzen Grün und Braun gekennzeichnet). Diese Lösung
wird gleichfalls von den Konstrukteuren des deutschen LEOPARD 2 für
zulässig angesehen, wenn auch der Dieselkraftstoff konsequent
aus dem Kampfraum des LEOPARD verbannt worden ist, und sie findet
sich auch in vielen anderen Kampfpanzern wieder. Beim Kampfpanzer
M1 Abrams hingegen wurde im Wannenbug keine Munition untergebracht,
jedoch war es unvermeidlich, wegen des hohen Kraftstoffverbrauch
der Gasturbine, beiderseits des Fahrerplatzes Kraftstoffbehälter
unterzubringen..
Um
die geforderte Gesamtanzahl Geschosse und Treibladungen für
die vorgesehene Munitionsbeladung zu erreichen,
hielten es die sowjetischen Konstrukteure für hinnehmbar, einige Treibladungen
und APFSDS-Geschosse mit ihrer Zusatztreibladung offen und ungeschützt
auf dem Turmkorbboden über dem Munitionsmagazin und an
den seitlichen Munitionshalterungen (Bild 12) in der Wanne unterzubringen
(in den Skizzen ROT gekennzeichnet). Diese offen untergebrachte
Munition ist in hohem Maße entzündungsgefährdet,
insbesondere durch einen Hohlladungsstrahl oder glühende
Sekundärsplitter.
Diese Gefahr war bekannt
und führte in verschiedenen Kampfhandlungen in mehreren
Fällen zur völligen Zerstörung von Kampfpanzern
T-72. Spätestens Ende der 80er Jahre begann deshalb die Ausstattung der russischen
Kampfpanzer mit einer modernen Explosionsunterdrückungsanlage,
wie sie sich in den israelischen Kampfpanzern MERKAVA bereits als 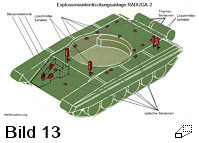 außerordentlich
wirksam erwiesen hatte. Die bisherige automatische Feuerlöschanlage
hatte den Nachteil, dass die Sensoren erst 1 bis 2 Sekunden den
Temperaturen eines Brandes ausgesetzt sein mussten, ehe die Löschanlage ansprechen
konnte. Die Explosionsunterdrückungsanlage
RADUGA-2 (Bild 13) nutzt nun im Kampfraum optische Sensoren zur Detektion eines
gefährlichen Temperaturanstieges. Dadurch ist es möglich,
innerhalb von 150 Millisekunden das Löschmittel in die
Gefahrenzone zu leiten und eine Entzündung der Munition
zu verhindern. Es muss bemerkt werden, dass die mitverbrennende
Zellulosehülle der russischen Treibladungen unter Sauerstoffentzug
nicht brennbar ist. Eine weitere Maßnahme zur Vermeidung
von Munitionsentzündungen ist die weitestgehende Abschottung
der Treibladungshüllen vor der Wirkung von glühenden
Sekundärsplittern. Grundsätzlich sind die Munitionskassetten
relativ lückenlos durch den über dem Magazin befindlichen
Turmkorbboden und seitliche Blenden geschützt, so dass
Splitter kaum in das Innere außerordentlich
wirksam erwiesen hatte. Die bisherige automatische Feuerlöschanlage
hatte den Nachteil, dass die Sensoren erst 1 bis 2 Sekunden den
Temperaturen eines Brandes ausgesetzt sein mussten, ehe die Löschanlage ansprechen
konnte. Die Explosionsunterdrückungsanlage
RADUGA-2 (Bild 13) nutzt nun im Kampfraum optische Sensoren zur Detektion eines
gefährlichen Temperaturanstieges. Dadurch ist es möglich,
innerhalb von 150 Millisekunden das Löschmittel in die
Gefahrenzone zu leiten und eine Entzündung der Munition
zu verhindern. Es muss bemerkt werden, dass die mitverbrennende
Zellulosehülle der russischen Treibladungen unter Sauerstoffentzug
nicht brennbar ist. Eine weitere Maßnahme zur Vermeidung
von Munitionsentzündungen ist die weitestgehende Abschottung
der Treibladungshüllen vor der Wirkung von glühenden
Sekundärsplittern. Grundsätzlich sind die Munitionskassetten
relativ lückenlos durch den über dem Magazin befindlichen
Turmkorbboden und seitliche Blenden geschützt, so dass
Splitter kaum in das Innere 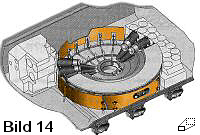 des
Magazins gelangen können. Um den Schutz gerade des Magazins
weiter zu erhöhen, wurde ab dem Modell T-72B das Magazin
mit einer seitlichen Isolationswand (Bild 14) versehen und der Turmkorbboden
modifiziert. Alle getroffenen Maßnahmen konnten die Gefahr
einer Munitionsexplosion erheblich verringern. des
Magazins gelangen können. Um den Schutz gerade des Magazins
weiter zu erhöhen, wurde ab dem Modell T-72B das Magazin
mit einer seitlichen Isolationswand (Bild 14) versehen und der Turmkorbboden
modifiziert. Alle getroffenen Maßnahmen konnten die Gefahr
einer Munitionsexplosion erheblich verringern.
Völlig ausschließen
lässt sich freilich eine Entzündung der Treibladungen
nicht. Auswertungen aus den Kriegen mit Beteiligung von T-72
zeigten, dass für die folgenreichen Munitionsexplosionen
in erster Linie Folgebrände verantwortlich waren.
Wie kompliziert die Auflösung des Widerspruchs zwischen
der erforderlichen Munitionsbeladung und dem Bemühen um
vollständige Isolation der Munition von der Besatzung ist,
zeigt der internationale Panzerbau recht anschaulich. In den
meisten Kampfpanzern, so im Leopard 2 und auch im französischen
LECLERC befindet sich der überwiegende Teil der mitgeführten
Munition in einem Munitionsgestell im vorderen Wannenbereich.
Die Entwickler gehen offensichtlich weiterhin davon aus, dass die Wannenpanzerung und
die eingebaute Explosionsunterdrückungsanlage ausreichendenden
Schutz bietet.
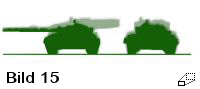 Ein
nicht zu unterschätzendes Kriterium ist
die Größe des Kampfpanzers. Entschließen sich
die Konstrukteure, den Hauptteil oder wenigstens die Bereitschaftsmunition
in einem isolierten Bunker im Turmheck unterzubringen, vergrößert
sich unvermeidlich das Turmvolumen (Bild 15) und damit die Wahrscheinlichkeit
eines Treffers im Turm. In den meisten Fällen wird der
Kampfpanzer damit seine Gefechtstauglichkeit verlieren. Jedoch
führt selbst eine Explosion der Munition im isolierten
Turmbunker wegen der Ableitung der Detonationswelle über
Sollbruchstellen an der Oberseite des Turmbunkers nicht zu einer Gefährdung der Besatzung, jedenfalls
soweit im Moment der Explosion die Munitionsbunkertür geschlossen
war. Ein
nicht zu unterschätzendes Kriterium ist
die Größe des Kampfpanzers. Entschließen sich
die Konstrukteure, den Hauptteil oder wenigstens die Bereitschaftsmunition
in einem isolierten Bunker im Turmheck unterzubringen, vergrößert
sich unvermeidlich das Turmvolumen (Bild 15) und damit die Wahrscheinlichkeit
eines Treffers im Turm. In den meisten Fällen wird der
Kampfpanzer damit seine Gefechtstauglichkeit verlieren. Jedoch
führt selbst eine Explosion der Munition im isolierten
Turmbunker wegen der Ableitung der Detonationswelle über
Sollbruchstellen an der Oberseite des Turmbunkers nicht zu einer Gefährdung der Besatzung, jedenfalls
soweit im Moment der Explosion die Munitionsbunkertür geschlossen
war.
Die
Konstrukteure vom Omsker Panzerwerk untersuchten wegen der bekannten Probleme
auch alternative Lösungsmöglichkeiten für die
Unterbringung der Ladeeinrichtung.
In einem Patent aus dem Jahre 2001 werden Varianten vorgeschlagen,
die bereits vorhandene 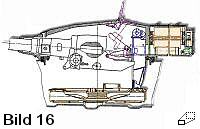 Ladeeinrichtung mit einem zusätzlichen Bandlader
im Turmheck zu kombinieren. Ein solcher Bandlader kann
an die vorhandenen Türme ohne erhebliche Veränderungen
am Gesamtkonzept angefügt werden. In der Variante 1 (Bild 16)
werden
ausschließlich die teilverbrennenden Treibladungen in ein Bandmagazin
ausgelagert. Die Geschosse verbleiben im modifizierten, sehr
flachen Magazin am Boden der Wanne. Beim Auslösen des Ladevorgangs
wird die Kassette mit dem Geschoss durch die Hubeinrichtung bis zur
Zuführlinie angehoben, worauf sich das Schott zum Bandlader
öffnet und der Kettenansetzer die Treibladung in einem
Zug mit dem Geschoss in den Ladungsraum einführt. Vorteilhaft
ist ohne Zweifel, dass die hochgefährdeten Treibladungen
vom Kampfraum isoliert werden und sich der Zeitaufwand für
den Ladezyklus deutlich verringert. Ladeeinrichtung mit einem zusätzlichen Bandlader
im Turmheck zu kombinieren. Ein solcher Bandlader kann
an die vorhandenen Türme ohne erhebliche Veränderungen
am Gesamtkonzept angefügt werden. In der Variante 1 (Bild 16)
werden
ausschließlich die teilverbrennenden Treibladungen in ein Bandmagazin
ausgelagert. Die Geschosse verbleiben im modifizierten, sehr
flachen Magazin am Boden der Wanne. Beim Auslösen des Ladevorgangs
wird die Kassette mit dem Geschoss durch die Hubeinrichtung bis zur
Zuführlinie angehoben, worauf sich das Schott zum Bandlader
öffnet und der Kettenansetzer die Treibladung in einem
Zug mit dem Geschoss in den Ladungsraum einführt. Vorteilhaft
ist ohne Zweifel, dass die hochgefährdeten Treibladungen
vom Kampfraum isoliert werden und sich der Zeitaufwand für
den Ladezyklus deutlich verringert.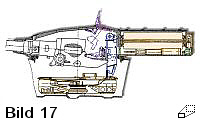 Dennoch befinden sich immer
noch APFSDS-Geschosse mit Zusatztreibladung im Kampfraum, wenn
auch ihre Gefährdung durch Treffer erheblich gesunken ist.
In
der Variante 2 (Bild 17) wird vorgeschlagen, einen Bandlader am Turmheck
zusätzlich zum bisherigen
Magazin am Wannenboden anzubringen. Hier muss die
Steuerung der beiden Ladeeinrichtungen faktisch zwei unterschiedliche
Steuerprogramme ermöglichen, je eines für jede der beiden
voneinander unabhängigen
Ladeeinrichtungen. Es mag vorteilhaft
sein, dass bei Ausfall einer der beiden Ladeeinrichtungen
eine vollständig redundante Einrichtung verfügbar
ist. Der Bandlader im Turmheck kann darüber hinaus die
Munition aufnehmen, die bisher mehr oder weniger offen im Kampfraum
untergebracht werden musste. Allerdings führt diese Variante
zu einer erheblichen Vergrößerung der Ausmaße
des Turms und erhöht die Anforderungen an den Antrieb des
Horizontalstabilisators wegen der Zunahme der Kräfteasymmetrie
bei zunehmender Leerung des Bandladers. Dennoch befinden sich immer
noch APFSDS-Geschosse mit Zusatztreibladung im Kampfraum, wenn
auch ihre Gefährdung durch Treffer erheblich gesunken ist.
In
der Variante 2 (Bild 17) wird vorgeschlagen, einen Bandlader am Turmheck
zusätzlich zum bisherigen
Magazin am Wannenboden anzubringen. Hier muss die
Steuerung der beiden Ladeeinrichtungen faktisch zwei unterschiedliche
Steuerprogramme ermöglichen, je eines für jede der beiden
voneinander unabhängigen
Ladeeinrichtungen. Es mag vorteilhaft
sein, dass bei Ausfall einer der beiden Ladeeinrichtungen
eine vollständig redundante Einrichtung verfügbar
ist. Der Bandlader im Turmheck kann darüber hinaus die
Munition aufnehmen, die bisher mehr oder weniger offen im Kampfraum
untergebracht werden musste. Allerdings führt diese Variante
zu einer erheblichen Vergrößerung der Ausmaße
des Turms und erhöht die Anforderungen an den Antrieb des
Horizontalstabilisators wegen der Zunahme der Kräfteasymmetrie
bei zunehmender Leerung des Bandladers.
Für
ihr Projekt Kampfpanzer BLACK EAGLE entwickelte das Konstruktionsbüro
KBTM
in Omsk ein Ladeeinrichtung, die ausschließlich
auf einen Bandlader am Turmheck setzt (Bild 18). Das Besondere an dieser
Ladeeinrichtung besteht darin, dass sich die gesamte Ladeeinrichtung  zusammen
mit der Munition in einem abgeschlossenen, abnehmbaren Gehäuse befindet,
das
am Turmheck eingehängt wird und das ohne Aufwand gewechselt
werden kann. Durch eine entsprechende
Logistikkette werden den Kampfpanzern somit die Ersatzmagazine bis
ins Gefecht zugeführt, wo sie an Ort und Stelle bei
minimalem Zeitaufwand durch ein geschütztes Transport-Ladefahrzeug
gewechselt
werden können. Geschoss und Treibladung liegen in den Kassetten
des Bandladers hintereinander und werden durch ein Panzerschott
hindurch in einem Zug in den Ladungsraum zugeführt. Jede
Gefährdung der Besatzung wird damit auf eine Minimalmaß
reduziert. Die Ladeeinrichtung erlaubt auch die Verwendung patronierter
Munition füe eine Kanone anderer Kaliber. Allerdings erscheint
der finanzielle und logistische Aufwand bei Beschaffung eines solch komplexen
Systems
erheblich, ist doch jeder einzelne dieser Transport-Lade-Container mit einem
vollständigen Bandmagazin und den dazugehörigen elektrischen
und elektronischen Baugruppen
ausgestattet. Darüber hinaus sollte die Anzahl der zu beschaffenden
Transport-Lade-Container größer sein als die entsprechende
Anzahl Kampfpanzer. Letztendlich ist zum Schließen der
Logistikkette auch noch die notwendige
Anzahl geschützter Transport-Lade-Fahrzeuge zu beschaffen. zusammen
mit der Munition in einem abgeschlossenen, abnehmbaren Gehäuse befindet,
das
am Turmheck eingehängt wird und das ohne Aufwand gewechselt
werden kann. Durch eine entsprechende
Logistikkette werden den Kampfpanzern somit die Ersatzmagazine bis
ins Gefecht zugeführt, wo sie an Ort und Stelle bei
minimalem Zeitaufwand durch ein geschütztes Transport-Ladefahrzeug
gewechselt
werden können. Geschoss und Treibladung liegen in den Kassetten
des Bandladers hintereinander und werden durch ein Panzerschott
hindurch in einem Zug in den Ladungsraum zugeführt. Jede
Gefährdung der Besatzung wird damit auf eine Minimalmaß
reduziert. Die Ladeeinrichtung erlaubt auch die Verwendung patronierter
Munition füe eine Kanone anderer Kaliber. Allerdings erscheint
der finanzielle und logistische Aufwand bei Beschaffung eines solch komplexen
Systems
erheblich, ist doch jeder einzelne dieser Transport-Lade-Container mit einem
vollständigen Bandmagazin und den dazugehörigen elektrischen
und elektronischen Baugruppen
ausgestattet. Darüber hinaus sollte die Anzahl der zu beschaffenden
Transport-Lade-Container größer sein als die entsprechende
Anzahl Kampfpanzer. Letztendlich ist zum Schließen der
Logistikkette auch noch die notwendige
Anzahl geschützter Transport-Lade-Fahrzeuge zu beschaffen.
Ein
zweites Problem bei den sowjetischen automatischen Ladeeinrichtungen
der Bauserien T-64, T-80 und T-72 findet seine 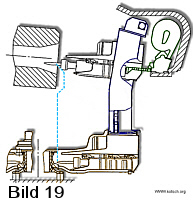 Ursache
darin, dass die Länge der verwendbaren APFSDS-Geschosse
durch die konstruktiven Besonderheiten des Munitionsmagazin
limitiert wird. Beim T-72 verhindert der Durchmesser der Nabenbaugruppe
des Magazins die Unterbringung von längeren Geschossen
in den Munitionskassetten. Zusätzlich können längere
Geschosse von der bisherigen Kassettenhubeinrichtung im T-72
nicht auf die Zuführlinie angehoben werden, da sich die
Spitze des verlängerten Geschosses bereits unterhalb des
Bodenstücks befindet und beim Anheben der Kassette mit
diesem kollidieren würde. Durch das Entwicklerteam von
URALVAGONZAVOD konnten für den T-90 die Probleme auf vergleichsweise
unkomplizierte Weise gelöst werden. Die Nabenbaugruppe
des Munitionsmagazins wurde deutlich verkleinert. Die konstruktiv
damit in Zusammenhang stehende bisherige elektromechanische
Einrichtung für die Speicherung der Kassettenbelegung wurde
durch eine erheblich kleinere, digital arbeitende Speichereinrichtung
ersetzt. Weiterhin wurde die Führung der beiden Gliederketten
der Kassettenhubeinrichtung verändert (Bild 19). Im Ergebnis der
Modifizierung wird die Kassette während des Anhebens im
Bereich des Bodenstücks kurzzeitig horizontal soweit nach
hinten versetzt, dass die Spitze des Ursache
darin, dass die Länge der verwendbaren APFSDS-Geschosse
durch die konstruktiven Besonderheiten des Munitionsmagazin
limitiert wird. Beim T-72 verhindert der Durchmesser der Nabenbaugruppe
des Magazins die Unterbringung von längeren Geschossen
in den Munitionskassetten. Zusätzlich können längere
Geschosse von der bisherigen Kassettenhubeinrichtung im T-72
nicht auf die Zuführlinie angehoben werden, da sich die
Spitze des verlängerten Geschosses bereits unterhalb des
Bodenstücks befindet und beim Anheben der Kassette mit
diesem kollidieren würde. Durch das Entwicklerteam von
URALVAGONZAVOD konnten für den T-90 die Probleme auf vergleichsweise
unkomplizierte Weise gelöst werden. Die Nabenbaugruppe
des Munitionsmagazins wurde deutlich verkleinert. Die konstruktiv
damit in Zusammenhang stehende bisherige elektromechanische
Einrichtung für die Speicherung der Kassettenbelegung wurde
durch eine erheblich kleinere, digital arbeitende Speichereinrichtung
ersetzt. Weiterhin wurde die Führung der beiden Gliederketten
der Kassettenhubeinrichtung verändert (Bild 19). Im Ergebnis der
Modifizierung wird die Kassette während des Anhebens im
Bereich des Bodenstücks kurzzeitig horizontal soweit nach
hinten versetzt, dass die Spitze des 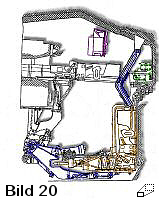 Geschosses
am Bodenstück vorbei geführt werden kann. Die neue
Kassettenführung erlaubt nun die Verwendung von APFSDS-Geschossen
mit einer Länge von bis zu 780 mm. Bei der Ladeeinrichtung
des T-64 und T-80 ist die maximale Länge der verwendbaren
APFSDS-Geschosse durch den angewinkelten Hubarm begrenzt. Die
ursprüngliche Version des Hubarms behindert in ihrer Position
im Falle der Unterbringung verlängerter Geschosse die Drehfreiheit
des Magazins. Durch eine Veränderung des Hubarms und Anbringung
eines horizontalen Durchgangs (Bild 20) können nun auch Geschosse
mit einer maximalen Länge von 700 mm verwendet werden.
Zusätzlich kann am Hubarm in optimaler Position die Programmiereinheit
für das System AINET angebracht werden. Befindet sich eine
Splitter-Spreng-Granate OF-26 in der Ladeposition über
dem Hubarm, ragt der elektronische Zünder der Granate in
den Wirkbereich der induktiv-elektronischen Programmiereinheit.
Dadurch kann der tempierbare Zünder entsprechend der Schussentfernung
mit dem gewünschten Detonationszeitpunkt programmiert werden. Geschosses
am Bodenstück vorbei geführt werden kann. Die neue
Kassettenführung erlaubt nun die Verwendung von APFSDS-Geschossen
mit einer Länge von bis zu 780 mm. Bei der Ladeeinrichtung
des T-64 und T-80 ist die maximale Länge der verwendbaren
APFSDS-Geschosse durch den angewinkelten Hubarm begrenzt. Die
ursprüngliche Version des Hubarms behindert in ihrer Position
im Falle der Unterbringung verlängerter Geschosse die Drehfreiheit
des Magazins. Durch eine Veränderung des Hubarms und Anbringung
eines horizontalen Durchgangs (Bild 20) können nun auch Geschosse
mit einer maximalen Länge von 700 mm verwendet werden.
Zusätzlich kann am Hubarm in optimaler Position die Programmiereinheit
für das System AINET angebracht werden. Befindet sich eine
Splitter-Spreng-Granate OF-26 in der Ladeposition über
dem Hubarm, ragt der elektronische Zünder der Granate in
den Wirkbereich der induktiv-elektronischen Programmiereinheit.
Dadurch kann der tempierbare Zünder entsprechend der Schussentfernung
mit dem gewünschten Detonationszeitpunkt programmiert werden.
Im
Jahre 2007 liess sich das Konstruktionsbüro für Transportmaschinenbau
in Nizhniy Tagil eine automatische Ladeeinrichtung patentieren,
die im Prinzip auf den Erfahrungen mit der Ladeeinrichtung des
T-72 aufbaut. Wie bisher ist die Munition in einem ringförmigen
Magazin unterhalb des Turmdrehkranzes in separat eingehängten
Kassetten untergebracht. Bei einer anzunehmenden Kanone des
Kalibers 125 mm und bei Weiterverwendung der bekannten
Treibladungen für diese Kanone, kann ein Fassungsvermögen
von mindestens 22, wahrscheinlich sogar von 28 Schuss angenommen werden.
Um eine Längenbegrenzung
bei APFSDS-Geschosssen und perspektivischen Lenkflugkörpern
auszuschließen, wurden die Kassetten nun in vertikaler
Lage 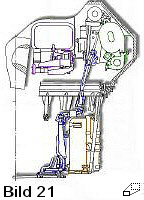 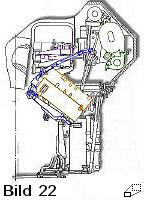 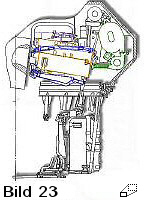 aufgestellt
(Bild 21).
Ein im Turmheck vor dem Kettenansetzer untergebrachter zweiteiliger
Schwenkarm hebt im Verlaufe des Ladevorganges die Kassette mit
der ausgewählten Munitionsart aus der Arretierung im Kassettentragring
heraus. Während des Anhebens (Bild 22) winkelt das untere Segment
des Hubarms gleichlaufend mit dem Hochschwenken des oberen Hubarmsegments
so ein, dass sich die Längsachse der Geschosskassette auf Höhe
der Zuführlinie synchron zur Rohrseelenachse
befindet (Bild 23). Nachdem der Kettenansetzer das Geschoss zugeführt
hat, schwenkt die Kassette eine Position nach oben, so dass
die Treibladung in den Ladungsraum zugeführt werden kann.
Mit dem Schließen des Verschlusskeils wird die Kassette
in umgekehrter Reihenfolge wieder im Kassettentragring des Magazins abgesetzt. aufgestellt
(Bild 21).
Ein im Turmheck vor dem Kettenansetzer untergebrachter zweiteiliger
Schwenkarm hebt im Verlaufe des Ladevorganges die Kassette mit
der ausgewählten Munitionsart aus der Arretierung im Kassettentragring
heraus. Während des Anhebens (Bild 22) winkelt das untere Segment
des Hubarms gleichlaufend mit dem Hochschwenken des oberen Hubarmsegments
so ein, dass sich die Längsachse der Geschosskassette auf Höhe
der Zuführlinie synchron zur Rohrseelenachse
befindet (Bild 23). Nachdem der Kettenansetzer das Geschoss zugeführt
hat, schwenkt die Kassette eine Position nach oben, so dass
die Treibladung in den Ladungsraum zugeführt werden kann.
Mit dem Schließen des Verschlusskeils wird die Kassette
in umgekehrter Reihenfolge wieder im Kassettentragring des Magazins abgesetzt.
Bemerkenswert
an dieser Ladeeinrichtung ist, dass der Innendurchmesser des
Magazinringes soweit in den Turminnenraum hineinragt, dass für
die ergonomisch vernünftige Unterbringung einer
Besatzung kein nutzbarer Raum frei bleibt. Die Hülsenfangeinrichtung
ist seitlich an der Kanone befestigt und wird vor dem Anheben
der Munitionskassette seitlich aus der Zuführlinie herausgeschwenkt.
Die Luke zum Auswerfen der beschossenen Hülsenböden
wurde vom Turmheck an die obere seitliche Turmpanzerung verlegt.
Es ist naheliegend anzunehmen, dass dieses Modell einer automatischen
Ladeeinrichtung für einen Kampfpanzer neuerer Generation
vorgesehen ist, bei dem die Besatzung nicht mehr im Turm sondern
in der Wanne untergebracht wird. Bereits im Jahre 2008 hatte
das berühmte Panzerwerk URALVAGONZAVOD angekündigt,
im Folgejahr das Geheimnis um den lang erwarteten russischen
Kampfpanzer der Zukunft zu lüften - den legendären
T-95. Jüngere Presseveröffentlichungen deuten allerdings
darauf hin, dass Nachfolger des Kampfpanzers T-90 nicht der
imaginäre "T-95" sein wird wie er seit Jahren
durch die Presse geistert. Einige Informationen
lassen die Vermutung aufkommen, dass die russischen Konstrukteure
ihren neuen, eher konventionellen Kampfpanzer mit einem Bandlader am Turmheck ausstatten
werden, der einer 125 mm Kanone in Verbindung mit einer
zeitgemäßen, hochintegrierten Feuerleitanlage eine
hohe Feuergeschwindigkeit erlaubt und auch die unkomplizierte
Umrüstung auf eine Kanone höheren Kalibers gestattet.
Literaturverzeichnis
1) Kampffahrzeuge der
Uraler Waggonwerke - Panzer T-54 / T-55, Media-Print, Russland,
Niznii Tagil, 2006
2) Kampffahrzeuge der Uraler Waggonwerke
- Panzer T-72, Media-Print, Russland, Niznii Tagil, 2004
3)
Kampffahrzeuge der Uraler Waggonwerke
- Panzer 1960-X, Media-Print, Russland, Niznii Tagil, 2007
4)
Sowjetisch-Russische Panzer 1905 - 2003, Elbe-Dnjepr-Verlag, BRD,
Klitschen, 2004
5) Technik und Bewaffnung, Verlag Techinform,
Hefte August 2008 und Oktober 2009, Moskau
6) Patent "Kampfraum
von Kampfpanzern", KBTM Omsk, 2002
7) Patent "Automatische
Ladeeinrichtung für Kanonen", KBTM Omsk, 2001
8)
Patent "Ladeautomatfür Panzerkanonen", UKBTM
Nizhniy Tagil, 2000
9) Patent "Ladeautomatfür Panzerkanonen",
UKBTM Nizhniy Tagil, 2005
10) Patent "Ladeautomat für
Panzerkanonen", UKBTM Nizhniy Tagil, 2007
11) Panzer
T-62A, Handbuch zum materiellen Teil und zur Nutzung, Militärverlag,
Moskau, 1968
12) Explosionsunterdrückungsanlage RADUGA-2,
Werbeprospekt, Firma ELEKTROMACHINA, 2007
13) Lehrbuch Schießen
aus Panzern, Militärverlag der DDR, 1986
14) Schusstafel
Panzer 87, Schweiz, 1987
Bildquellen
|
Bilder
|
|
|
1
|
Panzer
T-62A, Handbuch zum materiellen Teil und zur Nutzung, Militärverlag,
Moskau, 1968
|
|
2; 3; 4
|
Technik und Bewaffnung, Verlag Techinform,
Hefte August 2008 , Moskau
|
|
5; 6; 7;
20
|
Kampffahrzeuge der Uraler Waggonwerke
- Panzer T-72, Media-Print, Russland, Niznii Tagil, 2004
|
|
8; 9; 10;
11; 15
|
Verfasser
|
|
12
|
T-72BA,
Beschreibung und Nutzung, Militärverlag,
Moskau,
|
|
13
|
Explosionsunterdrückungsanlage RADUGA-2,
Werbeprospekt, Firma ELEKTROMACHINA, 2007
|
|
14
|
Technik und Bewaffnung, Verlag Techinform,
Hefte Oktober 2009 , Moskau
|
|
16; 17
|
Patent "Kampfraum
von Kampfpanzern", KBTM Omsk, 2002
|
|
18
|
Patent "Kampfraum
von Kampfpanzern", KBTM Omsk, 2001
|
|
19
|
Patent "Ladeautomatfür Panzerkanonen",
UKBTM Nizhniy Tagil, 2005
|
|
21; 22;
23
|
Patent "Ladeautomat
für
Panzerkanonen", UKBTM Nizhniy Tagil, 2007
|
|