Die
120 mm Kanone von Rheinmetall
Spätestens nach dem Erscheinen
des Kampfpanzers T-62 mit seiner 115
mm Glattrohrkanone wurde klar, das als Bewaffnung des
Nachfolgers für den Leopard 1 nur eine erheblich stärkere Kanone
in Betracht kommen konnte.
Im Jahre 1965 stellte die Firma Rheinmetall
nach grundsätzlichen Untersuchungen gesichert fest, das der geforderte
Leistungssprung gleichfalls nur mit einer glattrohrigen Kanone zu erreichen sein würde.
Deshalb wurde 1968 die Firma Rheinmetall beauftragt eine solche Panzerkanone
mit glattem Rohr und die dazugehörige
Munition zu entwickeln. Als Kaliber einigte man sich auf 120
mm um genügend Entwicklungsreserven für die Zukunft zu behalten.
 Die
zahlreichen Erprobungen in den Jahren 1975 bis 1977 zeigten, dass hier eine
hervorragende Waffe entwickelt worden war. Bei Vergleichsschießen
mit den Mustern der USA und Großbritanniens bewährte sich die
neue Kanone eindrucksvoll. Das neue flügelstabilisierte
KE-Geschoss übertraf zum damaligen Zeitpunkt alle Erwartungen
und lag in Treffgenauigkeit und endballistischer Leistung wesentlich über
den Werten der 105 mm Munition. Die USA entschlossen sich daraufhin im Jahr
1979 zum Nachbau dieser Kanone für den neuen Kampfpanzer M1. Auch
die niederländischen Streitkräfte waren schon früh zum Entschluß
gekommen den neuen Leopard 2 mit der 120 mm Kanone zu kaufen. Weitere Armeen
folgten. Die
zahlreichen Erprobungen in den Jahren 1975 bis 1977 zeigten, dass hier eine
hervorragende Waffe entwickelt worden war. Bei Vergleichsschießen
mit den Mustern der USA und Großbritanniens bewährte sich die
neue Kanone eindrucksvoll. Das neue flügelstabilisierte
KE-Geschoss übertraf zum damaligen Zeitpunkt alle Erwartungen
und lag in Treffgenauigkeit und endballistischer Leistung wesentlich über
den Werten der 105 mm Munition. Die USA entschlossen sich daraufhin im Jahr
1979 zum Nachbau dieser Kanone für den neuen Kampfpanzer M1. Auch
die niederländischen Streitkräfte waren schon früh zum Entschluß
gekommen den neuen Leopard 2 mit der 120 mm Kanone zu kaufen. Weitere Armeen
folgten.
Ausgangspunkt der Überlegungen
war die Forderung nach einem hohen ballistischen Leistungspotential, wobei
die Ausmaße der Kanone und ihre Rücklauflänge nicht wesentlich
über denen der britischen
L7 des Leopard 1 liegen durfte. Das war vor allem durch Anwendung
neuester Technologien möglich. In der bisher letzten Version des Leopard
2 wurde das Rohr auf eine Länge vom 55 Kalibern vergrößert
um eine noch höhere Anfangsgeschwindigkeit der unterkalibrigen KE-Geschosse
zu erreichen.
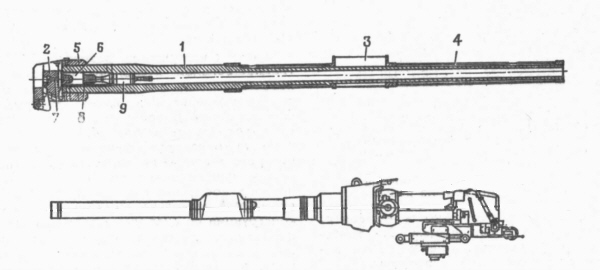 Das
Rohr der Kanone ist erzeugt aus vakuumgeschmolzenem Stahl, der
eine optimale Streckgrenze besitzt. Das kaltgereckte Rohr ist dadurch
in der Lage, einem Gasinnendruck beim Abschuss von etwa 7100 kp/cm2
standzuhalten. Um eine möglichst gleichmäßige
Verteilung der Materialspannungen im Rohr zu erreichen, was für
eine geringe Streuung bedeutsam ist, wird zusätzlich das
Verfahren der Autofrettage angewendet. Bei diesem Verfahren werden
durch gezielte Belastung des Rohres im letzten Herstellungsabschnitt
vorherbestimmte Eigenspannungen erzeugt. Abschließend wird das
Rohr von innen hartverchromt, um den Verschleiß herabzusetzen
und die Lebensdauer zu verlängern. Neu im Panzerbau war der
Einsatz von glasfaserverstärktem Kunststoff für die
Wärmeschutzhüllen und den Rauchabsauger in der Mitte des
Rohres. Neben der Wartungsfreiheit und relativen Robustheit waren
auch Gründe der optimalen Schwerpunktverteilung mit Zentrum in
den Schildzapfen ausschlaggebend. Hier wurden Grundlagen für
eine hohe Stabilisierungsgüte während des Schießens
aus der Bewegung geschaffen. Das
Rohr der Kanone ist erzeugt aus vakuumgeschmolzenem Stahl, der
eine optimale Streckgrenze besitzt. Das kaltgereckte Rohr ist dadurch
in der Lage, einem Gasinnendruck beim Abschuss von etwa 7100 kp/cm2
standzuhalten. Um eine möglichst gleichmäßige
Verteilung der Materialspannungen im Rohr zu erreichen, was für
eine geringe Streuung bedeutsam ist, wird zusätzlich das
Verfahren der Autofrettage angewendet. Bei diesem Verfahren werden
durch gezielte Belastung des Rohres im letzten Herstellungsabschnitt
vorherbestimmte Eigenspannungen erzeugt. Abschließend wird das
Rohr von innen hartverchromt, um den Verschleiß herabzusetzen
und die Lebensdauer zu verlängern. Neu im Panzerbau war der
Einsatz von glasfaserverstärktem Kunststoff für die
Wärmeschutzhüllen und den Rauchabsauger in der Mitte des
Rohres. Neben der Wartungsfreiheit und relativen Robustheit waren
auch Gründe der optimalen Schwerpunktverteilung mit Zentrum in
den Schildzapfen ausschlaggebend. Hier wurden Grundlagen für
eine hohe Stabilisierungsgüte während des Schießens
aus der Bewegung geschaffen.
 Das
Bodenstück, rechts im Bild, ist mit der Rücklaufeinrichtung
fest verbunden und mit dem Rohr über einen Bajonettverschluß
verschraubt. Das erlaubt ein schnelles Auswechseln der Rohres auch
unter Bedingungen der Feldinstandsetzung. Zum Öffnen des
Fallkeilverschlusses muß ein separater Öffnerhebel an der
linken Seite des Bodenstückes angesetzt werden. Zum Schließen
des Verschlusses muß eine gleichfalls separate Schließhilfe
gegen die Auswerferkrallen gedrückt werden bis diese den
Verschlußkeil freigeben. Durch Umlegen eines Hebels an der
Auflauframpe der Halbautomatik kann verhindert werden, dass der
Verschluss nach dem Schuss selbständig öffnet und den
Hülsenstummel auswirft. So beispielsweise bei Aufenthalt in
radioaktiv verseuchtem oder vergifteten Gelände, wenn die
Hermetisierung des Kampfraumes nicht gefährdet werden soll.
Alternativ kann natürlich auch sofort eine neue Patrone geladen
werden. Im Verschlußkeil befindet sich die Kontakteinrichtung
für das elektrische Zünden der Treibladung der Patronen.
Nach dem Auswerfen des Treibladungsstummels fällt dieser beim
Leopard 2 gegen eine Prallfläche und wird nach unten in einen
Hülsenkasten umgelenkt. Die Prallfläche ist ein
bewegliches, federnd gelagertes Teil, dessen obere Fläche beim
Laden der Patronen als Ladehilfe dient. Ähnlich ist dies auch
beim Kampfpanzer M1 der Fall. Das
Bodenstück, rechts im Bild, ist mit der Rücklaufeinrichtung
fest verbunden und mit dem Rohr über einen Bajonettverschluß
verschraubt. Das erlaubt ein schnelles Auswechseln der Rohres auch
unter Bedingungen der Feldinstandsetzung. Zum Öffnen des
Fallkeilverschlusses muß ein separater Öffnerhebel an der
linken Seite des Bodenstückes angesetzt werden. Zum Schließen
des Verschlusses muß eine gleichfalls separate Schließhilfe
gegen die Auswerferkrallen gedrückt werden bis diese den
Verschlußkeil freigeben. Durch Umlegen eines Hebels an der
Auflauframpe der Halbautomatik kann verhindert werden, dass der
Verschluss nach dem Schuss selbständig öffnet und den
Hülsenstummel auswirft. So beispielsweise bei Aufenthalt in
radioaktiv verseuchtem oder vergifteten Gelände, wenn die
Hermetisierung des Kampfraumes nicht gefährdet werden soll.
Alternativ kann natürlich auch sofort eine neue Patrone geladen
werden. Im Verschlußkeil befindet sich die Kontakteinrichtung
für das elektrische Zünden der Treibladung der Patronen.
Nach dem Auswerfen des Treibladungsstummels fällt dieser beim
Leopard 2 gegen eine Prallfläche und wird nach unten in einen
Hülsenkasten umgelenkt. Die Prallfläche ist ein
bewegliches, federnd gelagertes Teil, dessen obere Fläche beim
Laden der Patronen als Ladehilfe dient. Ähnlich ist dies auch
beim Kampfpanzer M1 der Fall.
Die
Munition befindet sich im Turm in einem abgetrennten Raum hinter
einem Panzerschott das nur zum Entnehmen der Patrone geöffnet
und sofort danach wieder geschlossen wird. Der Schalter zum
elektromechanischen Betätigen des Schotts befindet sich hinter
der halbkugelförmigen Klappe, im Bild rechts unten zu erkennen.
Nach dem Öffnen
des Schotts kann der Ladeschütze mittig
beginnend Patronen aus den vorhandenen 15 Munitionsaufnahmen
entnehmen, dabei werden durch Federn die folgenden Patronen zur Mitte
nachgeschoben. Der dunkelgrüne Kasten ist der Anschluß der
Bordsprechanlage beim Ladeschützen.
Links im Bild ist das
geschlossene Schott zur Bereitschaftsmunition im Turmheck gut zu
erkennen. Im Falle eines Treffers in die Munitionskammer kann sich
der Explosionsdruck über Sollbruchstellen an der Turmoberseite
nach oben entspannen und dringt nicht durch das Schott in den
Kampfraum ein. Zum Laden kann der Ladeschütze an seinem
Bedienpult einen individuellen Rohrerhöhungswinkel einstellen,
in den die Kanone nach jedem Schuss selbständig einläuft
und in dieser Stellung gezurrt bleibt bis der Ladeschütze die
Feuertaste an seinem Bedienpult betätigt.
Die
Rücklaufeinrichtung hat einen ähnlichen Aufbau wie beim
Leopard 1 und setzt sich zusammen aus zwei symetrisch angeordneten
exzentrischen Rücklaufbremsen und einem einseitig exzentrisch
angeordneten Rohrvorholer. Dabei ist es gelungen die Konstruktion so
auszuführen, dass der Rücklauf trotz erheblich größerer
Kräfte nur geringfügig größer
als bei der 105 mm L7
ist.
Hier noch eine
Reihe Fotos zur 120 mm Kanone Rheinmetall.
|

Bodenstück
1
|

Bodenstück
2
|

Bodenstück
3
|
|

Bodenstück
4
|

Bodenstück
5
|

Bodenstück
6
|
|

Hülsenkasten
|

geöffnete
Munitionstür
|
|
|

 Die
zahlreichen Erprobungen in den Jahren 1975 bis 1977 zeigten, dass hier eine
hervorragende Waffe entwickelt worden war. Bei Vergleichsschießen
mit den Mustern der USA und Großbritanniens bewährte sich die
neue Kanone eindrucksvoll. Das neue
Die
zahlreichen Erprobungen in den Jahren 1975 bis 1977 zeigten, dass hier eine
hervorragende Waffe entwickelt worden war. Bei Vergleichsschießen
mit den Mustern der USA und Großbritanniens bewährte sich die
neue Kanone eindrucksvoll. Das neue 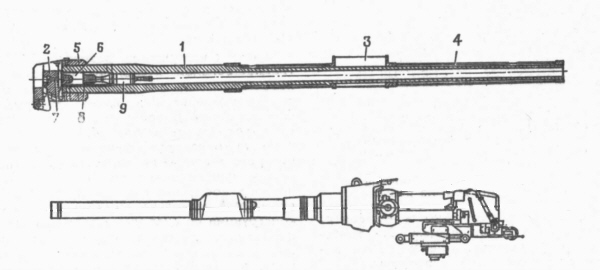 Das
Rohr der Kanone ist erzeugt aus vakuumgeschmolzenem Stahl, der
eine optimale Streckgrenze besitzt. Das kaltgereckte Rohr ist dadurch
in der Lage, einem Gasinnendruck beim Abschuss von etwa 7100 kp/cm2
standzuhalten. Um eine möglichst gleichmäßige
Verteilung der Materialspannungen im Rohr zu erreichen, was für
eine geringe Streuung bedeutsam ist, wird zusätzlich das
Verfahren der Autofrettage angewendet. Bei diesem Verfahren werden
durch gezielte Belastung des Rohres im letzten Herstellungsabschnitt
vorherbestimmte Eigenspannungen erzeugt. Abschließend wird das
Rohr von innen hartverchromt, um den Verschleiß herabzusetzen
und die Lebensdauer zu verlängern. Neu im Panzerbau war der
Einsatz von glasfaserverstärktem Kunststoff für die
Wärmeschutzhüllen und den Rauchabsauger in der Mitte des
Rohres. Neben der Wartungsfreiheit und relativen Robustheit waren
auch Gründe der optimalen Schwerpunktverteilung mit Zentrum in
den Schildzapfen ausschlaggebend. Hier wurden Grundlagen für
eine hohe Stabilisierungsgüte während des Schießens
aus der Bewegung geschaffen.
Das
Rohr der Kanone ist erzeugt aus vakuumgeschmolzenem Stahl, der
eine optimale Streckgrenze besitzt. Das kaltgereckte Rohr ist dadurch
in der Lage, einem Gasinnendruck beim Abschuss von etwa 7100 kp/cm2
standzuhalten. Um eine möglichst gleichmäßige
Verteilung der Materialspannungen im Rohr zu erreichen, was für
eine geringe Streuung bedeutsam ist, wird zusätzlich das
Verfahren der Autofrettage angewendet. Bei diesem Verfahren werden
durch gezielte Belastung des Rohres im letzten Herstellungsabschnitt
vorherbestimmte Eigenspannungen erzeugt. Abschließend wird das
Rohr von innen hartverchromt, um den Verschleiß herabzusetzen
und die Lebensdauer zu verlängern. Neu im Panzerbau war der
Einsatz von glasfaserverstärktem Kunststoff für die
Wärmeschutzhüllen und den Rauchabsauger in der Mitte des
Rohres. Neben der Wartungsfreiheit und relativen Robustheit waren
auch Gründe der optimalen Schwerpunktverteilung mit Zentrum in
den Schildzapfen ausschlaggebend. Hier wurden Grundlagen für
eine hohe Stabilisierungsgüte während des Schießens
aus der Bewegung geschaffen.
 Das
Bodenstück, rechts im Bild, ist mit der Rücklaufeinrichtung
fest verbunden und mit dem Rohr über einen Bajonettverschluß
verschraubt. Das erlaubt ein schnelles Auswechseln der Rohres auch
unter Bedingungen der Feldinstandsetzung. Zum Öffnen des
Fallkeilverschlusses muß ein separater Öffnerhebel an der
linken Seite des Bodenstückes angesetzt werden. Zum Schließen
des Verschlusses muß eine gleichfalls separate Schließhilfe
gegen die Auswerferkrallen gedrückt werden bis diese den
Verschlußkeil freigeben. Durch Umlegen eines Hebels an der
Auflauframpe der Halbautomatik kann verhindert werden, dass der
Verschluss nach dem Schuss selbständig öffnet und den
Hülsenstummel auswirft. So beispielsweise bei Aufenthalt in
radioaktiv verseuchtem oder vergifteten Gelände, wenn die
Hermetisierung des Kampfraumes nicht gefährdet werden soll.
Alternativ kann natürlich auch sofort eine neue Patrone geladen
werden. Im Verschlußkeil befindet sich die Kontakteinrichtung
für das elektrische Zünden der Treibladung der Patronen.
Nach dem Auswerfen des Treibladungsstummels fällt dieser beim
Leopard 2 gegen eine Prallfläche und wird nach unten in einen
Hülsenkasten umgelenkt. Die Prallfläche ist ein
bewegliches, federnd gelagertes Teil, dessen obere Fläche beim
Laden der Patronen als Ladehilfe dient. Ähnlich ist dies auch
beim Kampfpanzer M1 der Fall.
Das
Bodenstück, rechts im Bild, ist mit der Rücklaufeinrichtung
fest verbunden und mit dem Rohr über einen Bajonettverschluß
verschraubt. Das erlaubt ein schnelles Auswechseln der Rohres auch
unter Bedingungen der Feldinstandsetzung. Zum Öffnen des
Fallkeilverschlusses muß ein separater Öffnerhebel an der
linken Seite des Bodenstückes angesetzt werden. Zum Schließen
des Verschlusses muß eine gleichfalls separate Schließhilfe
gegen die Auswerferkrallen gedrückt werden bis diese den
Verschlußkeil freigeben. Durch Umlegen eines Hebels an der
Auflauframpe der Halbautomatik kann verhindert werden, dass der
Verschluss nach dem Schuss selbständig öffnet und den
Hülsenstummel auswirft. So beispielsweise bei Aufenthalt in
radioaktiv verseuchtem oder vergifteten Gelände, wenn die
Hermetisierung des Kampfraumes nicht gefährdet werden soll.
Alternativ kann natürlich auch sofort eine neue Patrone geladen
werden. Im Verschlußkeil befindet sich die Kontakteinrichtung
für das elektrische Zünden der Treibladung der Patronen.
Nach dem Auswerfen des Treibladungsstummels fällt dieser beim
Leopard 2 gegen eine Prallfläche und wird nach unten in einen
Hülsenkasten umgelenkt. Die Prallfläche ist ein
bewegliches, federnd gelagertes Teil, dessen obere Fläche beim
Laden der Patronen als Ladehilfe dient. Ähnlich ist dies auch
beim Kampfpanzer M1 der Fall.