Ladeautomat
des AMX-13 / Jagdpanzer Kürassier
Die Entwicklungsarbeiten zu
einem neuen leichten Panzer begannen im Auftrag der französischen
Regierung im Jahr 1946. Schon 1949 wurde ein erstes Muster
vorgestellt. Im Jahr 1951 begann die Serienproduktion. Der Turm des
AMX-13 wurde auch für den österreichischen Jagdpanzer Kürassier
übernommen, der sich noch im aktiven Dienst befindet.
 Für
diesen Panzer wurde ein völlig neuartiger Turm vom Typ FL-10
entwickelt. Die Turmbasis und das Turmoberteil bilden getrennte
Baugruppen. Auf diesem Foto eines AMX-13 im Militärmuseum
Dresden, Deutschland ist dieser Aufbau gut zu erkennen. Die
Turmbasis gewährleistet das horizontale Richten und mit dem in
einem Gelenk aufgehängten Oberteil wird das vertikale Richten
sichergestellt. Die ursprüngliche 75 mm Kanone ist starr in der
Turmfront eingebaut. Es gibt nur ein bewegliches, rücklaufendes
Bauteil im Turm, das Bodenstück. Im Turmheck befinden sich 2
Ladetrommeln mit einem Fassungsvermögen von jeweils 6
Schuss. Durch die starre Anordnung von Kanone und
Ladetrommeln konnte man einen recht unkomplizierten
automatischen Lader installieren. Für die später eingebaute 105 mm Kanone M-57
des österreichischen Jagdpanzers Kürassier konnte der Lader
fast vollständig übernommen werden. Für
diesen Panzer wurde ein völlig neuartiger Turm vom Typ FL-10
entwickelt. Die Turmbasis und das Turmoberteil bilden getrennte
Baugruppen. Auf diesem Foto eines AMX-13 im Militärmuseum
Dresden, Deutschland ist dieser Aufbau gut zu erkennen. Die
Turmbasis gewährleistet das horizontale Richten und mit dem in
einem Gelenk aufgehängten Oberteil wird das vertikale Richten
sichergestellt. Die ursprüngliche 75 mm Kanone ist starr in der
Turmfront eingebaut. Es gibt nur ein bewegliches, rücklaufendes
Bauteil im Turm, das Bodenstück. Im Turmheck befinden sich 2
Ladetrommeln mit einem Fassungsvermögen von jeweils 6
Schuss. Durch die starre Anordnung von Kanone und
Ladetrommeln konnte man einen recht unkomplizierten
automatischen Lader installieren. Für die später eingebaute 105 mm Kanone M-57
des österreichischen Jagdpanzers Kürassier konnte der Lader
fast vollständig übernommen werden.
Es handelt sich um eine halbautomatische
Lade- und Auswurfeinrichtung. Mit ihrer Hilfe wird eine
Schussfolge von 10 - 12 Schuss pro Minute erreicht. Der
Rücklauf sichert die Energie für den Zuführermechanismus
ab. Zum Nachladen der Trommeln muss der Panzer das Gefechtsfeld
verlassen. Dabei werden die Patronen über zwei Luken im Turmdach in die
Ladetrommeln eingeführt.
A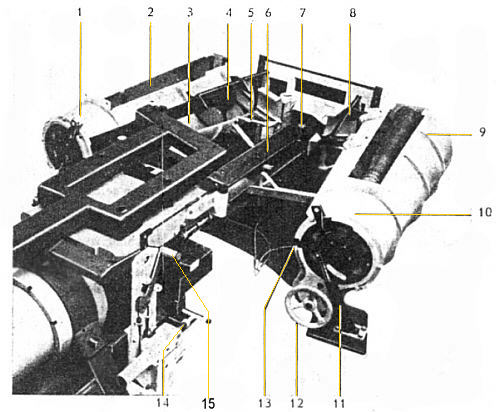 ufbau:In
jede Ladetrommel können 6 Granaten aufmunitioniert werden. Die
Ladetrommeln bestehen aus Blechmänteln (9) mit eingebauten
drehbaren Granatsternen (4). ufbau:In
jede Ladetrommel können 6 Granaten aufmunitioniert werden. Die
Ladetrommeln bestehen aus Blechmänteln (9) mit eingebauten
drehbaren Granatsternen (4).
Die Trommeln haben
je einen Einfüll- (2) und eine Abroll- öffnung (3).
Jeder
der beiden Granatsterne wird mit einem Spannrad (12) vorgespannt.
Die der roten Marke (13) gegenüber-stehende Zahl gibt die
Anzahl der in der Trommel befindlichen Granaten an. Spätere Varianten
besitzen einen mechanischen
Antrieb für die Ladetrommeln.
Bei der Entnahme
der Granaten aus der Trommel wird durch die Kraft der vorgespannten
Vierkant-Drehfedern der Granatstern in die gewünschte Stellung
gedreht. Beim Wechsel der Granatsterne von einer Stellung in die
andere werden die sehr starken Drehbewegungen durch den
hydraulischen Dämpfer (11) gedämpft. Die Drehbewegungen werden durch den
Trommelwähler (14)
ausgelöst. Durch Drehen des Griffes (14) nach links oder rechts
wird die entsprechende Ladetrommel vorgewählt, das heißt
der entsprechende Kabelzug in Eingriff gebracht. Beim Ziehen des
Griffes wird über den gewählten Kabelzug eine Klinke an
der entsprechenden Ladetrommel entsichert - der Granatstern
dreht sich, und die Patrone rollt durch die Abrollöffnung (3)auf
die Laderinne. Mit dem Ansetzer- Auslösehebel (15) wird der
Ansetzer (7) freigegeben und die in der Laderinne
(6) befindliche Patrone wird in das Patronenlager geschoben.. An den
Abrollöffnungen angebrachte Granatsperren (8) verhindern, dass
beim vollständigen Aufmunitionieren die zuerst eingefüllten
Granaten ungewollt aus den Trommel rollen. Die Granatsperren werden
durch die hinten an den Ladetrommeln befestigten Segmente gesteuert
und wirken automatisch.
 Die oben auf dem Turmheck befindlichen
Ladetüren ermöglichen das "Einfüllen" der
Granaten in die Ladetrommeln. Sie können von innen mit den
Ladetürverriegelungen gesichert werden. Die Ladetür über der rechten
Trommel, hier der Turm eines österreichischen Jagdpanzers Kürassier,
ist im linken Foto gut zu erkennen. Die oben auf dem Turmheck befindlichen
Ladetüren ermöglichen das "Einfüllen" der
Granaten in die Ladetrommeln. Sie können von innen mit den
Ladetürverriegelungen gesichert werden. Die Ladetür über der rechten
Trommel, hier der Turm eines österreichischen Jagdpanzers Kürassier,
ist im linken Foto gut zu erkennen.
Für das Nachladen
der Trommeln stehen beispielsweise beim Jagdpanzer Kürassier
weitere 31 Granatpatronen vom Kaliber 105mm zur Verfügung.
Davon sind 5 Patronen im Turmkorb vor dem Kommandantensitz untergebracht
und 26 Patronen befinden sich in Halterungen in der Wanne des
Panzers. Eine Patrone soll sich im Einsatzfall bereits im Patronenlager
der Kanone befinden.
Im Notbetrieb
ist es dem Kommandanten möglich die Kanone manuell aus der Munitionshalterung
vor seinem Sitz nachzuladen. Allerdings ist der verfügbare Raum
so erheblich eingeschränkt, das der Zeitbedarf bis zum Abschluß
des manuellen Ladens sehr hoch sein dürfte. Da die Ladeautomatik
zuverlässig funktioniert und auch mechanisch relativ robust
gebaut ist, wird es nur in seltenen Fällen notwendig sein manuell
nachzuladen.
Bedienung:
Das Laden durch die Ladeautomatik
kann wahlweise vom Platz des Kommandanten oder des Richtschützen
aus erfolgen. Zuerst muß die Marschzurrung der gewählten Munitionstrommel
gelöst werden. Der Kommandant dreht nun mit seinem seitlich
an der Kanone befindlichen Handrad die Ladetrommel bis die nächste
Patrone aus der Ladetrommel in die Patronenführung und dann
in die Laderinne der Ansetzvorrichtung gleitet. Will der Richtschütze
das Laden übernehmen, dann ist zunächst das Betätigungsgetriebe
für die Ladetrommeln mit einem Hebel umzustellen.
Durch
Betätigen des Ansetzerhebels wird die beim Rücklauf gespannte
Feder des Ansetzers freigegeben und schiebt die Patrone ins
Patronenlager. Der Rand der Hülse drückt die Auswerferkrallen
nach hinten und der Verschlußkeil schließt sich.


Im
linken Bild sieht man vom Platz des Kommandanten nach
oben in das Turmheck. Links oben befindet sich das Bodenstück
der Kanone mit dem Öffnerhebel an der Unterseite. Das große
schwarze Handrad ist der Hilfstrieb des Richtschützen. Oberhalb
des Handrades befindet sich der rote Umschalthebel für den Kommandanten
bzw. Richtschützen-Betrieb. Rechts vom Handrad ist das Getriebe
an dem die Antriebswelle des Kommandanten-Handrades endet. Das
rechte Bild zeigt die mechanische Ansetzervorrichtung
mit der Laderinne. Unterhalb der Laderinne befindet sich die
Teleskopstange mit der Ansetzerfeder. Die Stange wird beim Rücklauf
vom Bodenstück nach hintengeschoben, dabei spannt sich die Ansetzerfeder.
Der Mitnehmer des Ansetzers wird nach unten abgesenkt und gibt
den Weg zum Auswerfen der leeren Patronenhülse frei. Beim Rücklauf
wird gleichzeitig die Auswurfluke geöffnet und verriegelt und
die Feder für das Schließen der Auswurfluke gespannt. Die Patronenhülse
wird nach hinten ausgeworfen, gleitet dabei über den Entarretierungshebel
der Feder der Auswurflukenschließeinrichtung und fällt hinter dem Panzer zu Boden.
Der Entarretierungshebel schlägt zurück und gibt die Auswurflukeschließvorrichtung
frei.
Die Auswurfluke schließt sich und wird verriegelt, der Mitnehmer
des Ansetzers geht wieder in seine Ausgangsstellung. Die nächste Patrone kann
jetzt geladen werden.
Sicherungen:
Bei geschlossenem Verschluss ist der
Trommelwähler durch einen Schließkolben und ein
Sperrgestänge blockiert, um zu verhindern, dass bei
geladener Kanone eine Granate aus der Ladetrommel entnommen werden
kann. Nach erfolgter Betätigung des Trommelwählers bleibt
der Griff in ausgezogener Stellung blockiert, damit vor erfolgtem
Rohrücklauf keine weitere Granate auf die Ladeschaufel gelangen
kann.
Am
Bodenstück ist eine Auflaufkurve (4) angeschraubt, die den
Griff des Trommelwählers beim Rücklauf der Kanone
entriegelt und ihn wieder in seine Ausgangslage gleiten lässt.
Eine
Marschsicherung verhindert das selbstätige Drehen der Ladetrommeln,
so das es nicht zum unbeabsichtigten Herausfallen von Patronen
aus den Ladetrommeln kommen kann
 Das
linke Bild zeigt den Turm des AMX-13. Gut erkennbar ist die
Hülsenauswurfluke am Heck des Turmes. Auf der oberen Fläche
des Hecks befinde Das
linke Bild zeigt den Turm des AMX-13. Gut erkennbar ist die
Hülsenauswurfluke am Heck des Turmes. Auf der oberen Fläche
des Hecks befinde
n sich rechts und links die beiden Luken zum
aufmunitionieren der beiden Ladetrommeln.
Im Rahmen von Kampfwertsteigerungen wurden später
größerkalibrige Kanonen der Kaliber 90 mm und 105 mm
eingebaut, wobei der automatische Lader mit geringfügigen
Modifizierungen weiterverwendet werden konnte.
Zum Teil sind der
AMX-13 und seine Weiterentwicklungen noch heute im Truppeneinsatz,
wie dieser österreichische Jagdpanzer Kürassier. Dieser
hat den Turm des AMX-13 der weitgehend an die Anforderungen des österreichischen
Bundesheeres angepasst wurde. Insbesondere die Feuerleitanlage
und die Panzerwanne sind eine
eigenständige österreichische Entwicklungen.

Ein Dank geht auch an Peter Lau aus Singapore, der mich am
Anfang mit
technischen Skizzen unterstützt
hat.

|

 Für
diesen Panzer wurde ein völlig neuartiger Turm vom Typ FL-10
entwickelt. Die Turmbasis und das Turmoberteil bilden getrennte
Baugruppen. Auf diesem Foto eines AMX-13 im Militärmuseum
Dresden, Deutschland ist dieser Aufbau gut zu erkennen. Die
Turmbasis gewährleistet das horizontale Richten und mit dem in
einem Gelenk aufgehängten Oberteil wird das vertikale Richten
sichergestellt. Die ursprüngliche 75 mm Kanone ist starr in der
Turmfront eingebaut. Es gibt nur ein bewegliches, rücklaufendes
Bauteil im Turm, das Bodenstück. Im Turmheck befinden sich 2
Ladetrommeln mit einem Fassungsvermögen von jeweils 6
Schuss. Durch die starre Anordnung von Kanone und
Ladetrommeln konnte man einen recht unkomplizierten
automatischen Lader installieren. Für die später eingebaute
Für
diesen Panzer wurde ein völlig neuartiger Turm vom Typ FL-10
entwickelt. Die Turmbasis und das Turmoberteil bilden getrennte
Baugruppen. Auf diesem Foto eines AMX-13 im Militärmuseum
Dresden, Deutschland ist dieser Aufbau gut zu erkennen. Die
Turmbasis gewährleistet das horizontale Richten und mit dem in
einem Gelenk aufgehängten Oberteil wird das vertikale Richten
sichergestellt. Die ursprüngliche 75 mm Kanone ist starr in der
Turmfront eingebaut. Es gibt nur ein bewegliches, rücklaufendes
Bauteil im Turm, das Bodenstück. Im Turmheck befinden sich 2
Ladetrommeln mit einem Fassungsvermögen von jeweils 6
Schuss. Durch die starre Anordnung von Kanone und
Ladetrommeln konnte man einen recht unkomplizierten
automatischen Lader installieren. Für die später eingebaute 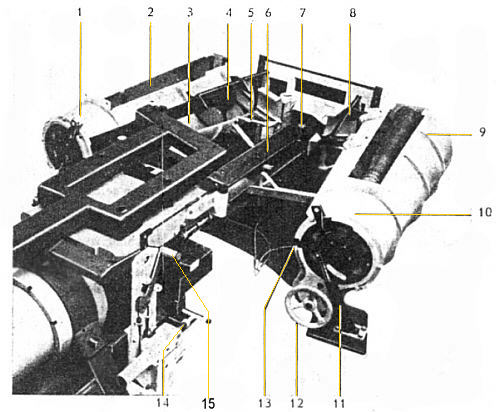 ufbau:In
jede Ladetrommel können 6 Granaten aufmunitioniert werden. Die
Ladetrommeln bestehen aus Blechmänteln (9) mit eingebauten
drehbaren Granatsternen (4).
ufbau:In
jede Ladetrommel können 6 Granaten aufmunitioniert werden. Die
Ladetrommeln bestehen aus Blechmänteln (9) mit eingebauten
drehbaren Granatsternen (4). Die oben auf dem Turmheck befindlichen
Ladetüren ermöglichen das "Einfüllen" der
Granaten in die Ladetrommeln. Sie können von innen mit den
Ladetürverriegelungen gesichert werden. Die Ladetür über der rechten
Trommel, hier der Turm eines österreichischen Jagdpanzers Kürassier,
ist im linken Foto gut zu erkennen.
Die oben auf dem Turmheck befindlichen
Ladetüren ermöglichen das "Einfüllen" der
Granaten in die Ladetrommeln. Sie können von innen mit den
Ladetürverriegelungen gesichert werden. Die Ladetür über der rechten
Trommel, hier der Turm eines österreichischen Jagdpanzers Kürassier,
ist im linken Foto gut zu erkennen. 

 Das
linke Bild zeigt den Turm des AMX-13. Gut erkennbar ist die
Hülsenauswurfluke am Heck des Turmes. Auf der oberen Fläche
des Hecks befinde
Das
linke Bild zeigt den Turm des AMX-13. Gut erkennbar ist die
Hülsenauswurfluke am Heck des Turmes. Auf der oberen Fläche
des Hecks befinde
