|

|
Die Feuerleitanlage des M1A1
Abrams
Part 1
Part
2
 Dem
Richtschützen des M1 stehen zwei Zielfernrohre zur Verfügung,
Ein Hauptzielfernrohr mit stabilisierter Visierlinie in der
vertikalen Ebene, integriertem Laser-Entfernungsmesser und Wärmebildkanal.
Der Ausblick befindet sich auf dem Turmdach. Das zweite Zielfernrohr
ist ein teleskopisches Tagzielfernrohr, das als Hilfszielfernrohr
bei Ausfall des Hauptzielfernrohres zur Verfügung steht. Dem
Richtschützen des M1 stehen zwei Zielfernrohre zur Verfügung,
Ein Hauptzielfernrohr mit stabilisierter Visierlinie in der
vertikalen Ebene, integriertem Laser-Entfernungsmesser und Wärmebildkanal.
Der Ausblick befindet sich auf dem Turmdach. Das zweite Zielfernrohr
ist ein teleskopisches Tagzielfernrohr, das als Hilfszielfernrohr
bei Ausfall des Hauptzielfernrohres zur Verfügung steht.
Bei
der Entwicklung des Hauptzielfernrohres entschlossen sich die
Konstrukteure auf die Stabilisierung der Visierlinie in zwei
Ebenen zu verzichten. Man war zur Auffassung gelangt, dass die
Stabilisierungsgenauigkeit nur in der vertikalen Ebene ausreichend hoch sein, um alle potentiellen
Ziele auf dem Gefechtsfeld treffsicher bekämpfen zu können.
Die Wahrscheinlichkeit, im realen Gefecht auf größere Entfernungen
aus der Bewegung bzw. aus dem Stand auf Ziele zu schießen, die
sich in Flankenfahrt befinden, wurde als relativ gering eingeschätzt.
Deshalb wollte man die Kompliziertheit des Systems verringern
und die Kosten senken. Allerdings zeigte sich, dass das neue
Zielfernrohr aufwendiger als das Zielfernrohr des Konkurrenten
Leopard 2 war und in einigen Kenndaten sogar ungünstigere
Werte besitzt. Dennoch hat sich das Zielfernrohr in realen Gefechten
als durchaus robust und ausreichend genau erwiesen.
Das folgende Bild zeigt einen Blick auf des Arbeitsplatz
des Richtschützen im M1 bzw. M1A1. In der Turmdecke aufgehängt,
 befindet
sich das modulartig aufgebaute Hauptzielfernrohr. Es stehen
zwei Vergrößerungen zur Verfügung, eine 9,5fache und eine 3fache
Vergrößerung im Tagkanal, sowie eine 9,8fache und eine 3fache
Vergrößerung im Wärmebildkanal. Der mechanische Hebel zum Wechseln
der Vergrößerung für den Tagkanal befindet sich unterhalb des
Okulars an der Gehäuseunterkante und für das Wärmebildmodul
rechts vom Okular zwischen den beiden Bedienblöcken. Zusätzlich ist ein 1:1 Einblick oberhalb des Okulars
vorhanden, der einen stabilisierten, direkten Blick ins Gelände
ermöglicht. Der monokulare Einblick des Hauptzielfernrohres mit
dem breiten Stirnschutz wird links flankiert vom Modul des Laser-Entfernungsmessers
und rechts vom Wärmebild-Modul. Die Module können bei Ausfällen
rasch ausgebaut und ersetzt werden. Unter dem Hauptzielfernrohr
befinden sich die Richtgriffe der elektrohydraulischen Richtanlage.
Links hinter den Richtgriffen befindet sich eine Handkurbel,
mit dem Abfeuerungsknopf der Kanone, für das manuelle Richten in der Vertikalen.
Rechts von den Richtgriffen befindet sich in hängender Position
die Handkurbel für das manuelle Drehen des Turmes. Der manuelle
Richtantrieb für den Turm muss durch Betätigen eines Handhebels
freigegeben werden, bei Nichtbenutzung ist die Kurbel über eine
Kupplung vom Getriebe abgetrennt. befindet
sich das modulartig aufgebaute Hauptzielfernrohr. Es stehen
zwei Vergrößerungen zur Verfügung, eine 9,5fache und eine 3fache
Vergrößerung im Tagkanal, sowie eine 9,8fache und eine 3fache
Vergrößerung im Wärmebildkanal. Der mechanische Hebel zum Wechseln
der Vergrößerung für den Tagkanal befindet sich unterhalb des
Okulars an der Gehäuseunterkante und für das Wärmebildmodul
rechts vom Okular zwischen den beiden Bedienblöcken. Zusätzlich ist ein 1:1 Einblick oberhalb des Okulars
vorhanden, der einen stabilisierten, direkten Blick ins Gelände
ermöglicht. Der monokulare Einblick des Hauptzielfernrohres mit
dem breiten Stirnschutz wird links flankiert vom Modul des Laser-Entfernungsmessers
und rechts vom Wärmebild-Modul. Die Module können bei Ausfällen
rasch ausgebaut und ersetzt werden. Unter dem Hauptzielfernrohr
befinden sich die Richtgriffe der elektrohydraulischen Richtanlage.
Links hinter den Richtgriffen befindet sich eine Handkurbel,
mit dem Abfeuerungsknopf der Kanone, für das manuelle Richten in der Vertikalen.
Rechts von den Richtgriffen befindet sich in hängender Position
die Handkurbel für das manuelle Drehen des Turmes. Der manuelle
Richtantrieb für den Turm muss durch Betätigen eines Handhebels
freigegeben werden, bei Nichtbenutzung ist die Kurbel über eine
Kupplung vom Getriebe abgetrennt.
 Die
Bedienelemente des Hauptzielfernrohres zeigt das linke Bild.
Oberhalb des Okulars befindet sich die Umschaltung der drei
Betriebsstufen der Feuerleitanlage MANUAL - NORMAL - EMERGENCY
sowie ein Dimmer und ein Testschalter für die Signalleuchten.
Darüber, im Bild nicht sichtbar, befindet sich der Hebel zum
Einschwenken des Prismas der Feldjustieranlage in das Sichtfeld
des Zielfernrohres. Unterhalb des Okulars befinden sich die zwei Potentiometer für
den vertikalen und horizontalen Driftabgleich und rechts daneben
ein mechanischer Drehgriff für die Lichtfilter. Links unterhalb
befindet sich der Munitionswahlschalter und davon rechts der
Waffenwahlschalter der elektrischen Abfeuerung für kanone bzw.
Turm-MG. An der Unterkante
ist der mechanische Hebel der Vergrößerungsumschaltung des Tagkanals
angebracht. Die
Bedienelemente des Hauptzielfernrohres zeigt das linke Bild.
Oberhalb des Okulars befindet sich die Umschaltung der drei
Betriebsstufen der Feuerleitanlage MANUAL - NORMAL - EMERGENCY
sowie ein Dimmer und ein Testschalter für die Signalleuchten.
Darüber, im Bild nicht sichtbar, befindet sich der Hebel zum
Einschwenken des Prismas der Feldjustieranlage in das Sichtfeld
des Zielfernrohres. Unterhalb des Okulars befinden sich die zwei Potentiometer für
den vertikalen und horizontalen Driftabgleich und rechts daneben
ein mechanischer Drehgriff für die Lichtfilter. Links unterhalb
befindet sich der Munitionswahlschalter und davon rechts der
Waffenwahlschalter der elektrischen Abfeuerung für kanone bzw.
Turm-MG. An der Unterkante
ist der mechanische Hebel der Vergrößerungsumschaltung des Tagkanals
angebracht.
Rechts von diesen Bedienfeldern schließt sich
das Bedienfeld des Wärmebildmoduls an. Von oben links nach rechts
der Kontrastwähler, der Polaritätsumschalter (warm = rot bzw.
warm = weiß), der Dimmer des Strichbildes, eine grüne und eine
rote Leuchte für den Betriebsstatus READY oder FAULT. Unter
dem Kontrastwähler befindet sich der EIN-STANDBY-AUS-Schalter,
rechts daneben ein Potentiometer für die Empfindlichkeit des
Wärmebildsensors, und ein Dimmer für die Symbole und die Entfernungsanzeig
im Okular. Unten links befindet sich ein Testschalter und rechts
daneben die Potentiometer für die Justierung des Hauptzielfernrohres
in der vertikalen und horizontalen Ebene über die Feldjustieranlage.. Oberhalb dieses Bedienfeldes
befindet sich der Hebel zum Wechseln der Vergrößerung des Wärmebildkanals.
Über dem Vergrößerungsumschalter befindet sich ein Potentiometer
zum Focussieren des Wärmebildmoduls von 50 Meter bis unendlich,
sowie ein weiterer Wahlschalter für die Einstellung der Empfindlichkeit
des Wärmebildmoduls.
 Das
Modul des Laser-Entfernungsmessers ist hängend links am Hauptzielfernrohrgehäuse
befestigt. Es befindet sich nur ein Bedienelement darauf, ein
Dreistellungsschalter. In Mittelstellung ist der Entfernungsmesser
ausgeschaltet, in den weiteren Stellungen ist der Laser scharfgeschaltet.
In der Stellung ARM LAST RTN berücksichtigt der Laser nur den
letzten reflektierten Laserstrahl, in der Stellung ARM 1ST RTN
nur den ersten reflektierten Laserstrahl. Dadurch können je
nach Geländebedingungen Fehlmessungen durch Mehrfachreflektionen
vermieden werden. Der Messbereich des Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat-Lasers beträgt 200 bis 7990 Meter, bei einer Messgenauigkeit
von ±10 Metern. Entfernungen oberhalb 4000 Metern werden nicht
mehr automatisch in den ballistischen Rechner übergeben. Die
Entfernung wird 4stellig im Okular angezeigt. Betriebsstörungen
werden mit dem Symbol F rechts oberhalb der Entfernungsanzeige
signalisiert. Ein waagerechter Strich über der Entfernungsanzeige
wird eingeleuchtet, wenn Mehrfachreflektionen auftreten. Bei
Fehlmessungen blinkt die Entfernungsanzeige mit vier Nullen
auf. Zusätzlich übernimmt das Entfernungsmessermodul die Aufgabe
ein rötliches Strichbild über einen Strahlenteiler und Prismen in
den Strahlengang des Okulars einzuleuchten. Der bewegliche Strahlenteiler
dient dazu, das Strichbild horizontal auszulenken, um notwendige
Vorhalten für bewegliche Ziele zur berücksichtigen. Diese Doppelfunktion
gewährleistet auch, dass die Entfernungsmessmarke immer mit
dem Zentrum des Strichbildes zusammenfällt. Das
Modul des Laser-Entfernungsmessers ist hängend links am Hauptzielfernrohrgehäuse
befestigt. Es befindet sich nur ein Bedienelement darauf, ein
Dreistellungsschalter. In Mittelstellung ist der Entfernungsmesser
ausgeschaltet, in den weiteren Stellungen ist der Laser scharfgeschaltet.
In der Stellung ARM LAST RTN berücksichtigt der Laser nur den
letzten reflektierten Laserstrahl, in der Stellung ARM 1ST RTN
nur den ersten reflektierten Laserstrahl. Dadurch können je
nach Geländebedingungen Fehlmessungen durch Mehrfachreflektionen
vermieden werden. Der Messbereich des Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat-Lasers beträgt 200 bis 7990 Meter, bei einer Messgenauigkeit
von ±10 Metern. Entfernungen oberhalb 4000 Metern werden nicht
mehr automatisch in den ballistischen Rechner übergeben. Die
Entfernung wird 4stellig im Okular angezeigt. Betriebsstörungen
werden mit dem Symbol F rechts oberhalb der Entfernungsanzeige
signalisiert. Ein waagerechter Strich über der Entfernungsanzeige
wird eingeleuchtet, wenn Mehrfachreflektionen auftreten. Bei
Fehlmessungen blinkt die Entfernungsanzeige mit vier Nullen
auf. Zusätzlich übernimmt das Entfernungsmessermodul die Aufgabe
ein rötliches Strichbild über einen Strahlenteiler und Prismen in
den Strahlengang des Okulars einzuleuchten. Der bewegliche Strahlenteiler
dient dazu, das Strichbild horizontal auszulenken, um notwendige
Vorhalten für bewegliche Ziele zur berücksichtigen. Diese Doppelfunktion
gewährleistet auch, dass die Entfernungsmessmarke immer mit
dem Zentrum des Strichbildes zusammenfällt.
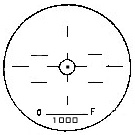 Der
Aufbau des Strichbildes entspricht dem bisherigen Standard für
Zielfernrohre. Ziele werden mit dem zentralen Kreuz angerichtet.
Der Punkt in der Mitte des Kreises entspricht der Laser-Messmarke.
Die senkrechten und waagerechten Striche dienen als Hilfsrichtmarken
zur Berücksichtigung von Vorhalten und zur Korrektur des Feuers
bei Ausfall der automatischen Feuerleitanlage. Der
Aufbau des Strichbildes entspricht dem bisherigen Standard für
Zielfernrohre. Ziele werden mit dem zentralen Kreuz angerichtet.
Der Punkt in der Mitte des Kreises entspricht der Laser-Messmarke.
Die senkrechten und waagerechten Striche dienen als Hilfsrichtmarken
zur Berücksichtigung von Vorhalten und zur Korrektur des Feuers
bei Ausfall der automatischen Feuerleitanlage.
Unten wird
Digital die gemessenen Entfernung angezeigt. Darüber befindet
sich der beschriebene
Balken für Mehrfachreflektionen, links die Feuerbereitanzeige
und rechts das F für die Anzeige von Fehlfunktionen.
 Dieses Bild zeigt einen Blick auf die Richtgriffe der elektrohydraulischen
Richtanlage. An jedem der beiden Griffe befinden sich drei,
in ihrer Funktion identische Schalter. Mit den Fingern ist der
Sicherheitsschalter gedrückt zu halten, mit dem die Sicherheitsblockierung
der Waffenstabilisierung freigegeben wird. Mit den Zeigefingern
wird die elektrische Abfeuerung betätigt. Dazu ist der Waffenwahlschalter
nach Bedarf auf Kanone oder Turm-MG zu stellen. Mit den Daumen wird
der Taster des Laser-Entfernungsmessers auf den Innenseiten
der Richtgriffe betätigt. Links oberhalb der Richtgriffe befindet
sich ein großer roter Griff, mit dem bei Ausfall der Stromversorgung
die Kanone manuell abgefeuert werden kann. Dazu muss der rote
Griff rasch verdreht werden, wobei ein Generator soviel Strom
an den Zündstift der elektrischen Abfeuerung der Kanone abgibt,
das die Treibladung zünden kann. Gut sichtbar ist links die
Kurbel der Hydraulikpumpe der manuellen Höhenrichtanlage mit
dem roten Abfeuerungsknopf und hinter dem rechten Richtgriff
die hängende Kurbel des manuellen Seitenrichtgetriebes.
Dieses Bild zeigt einen Blick auf die Richtgriffe der elektrohydraulischen
Richtanlage. An jedem der beiden Griffe befinden sich drei,
in ihrer Funktion identische Schalter. Mit den Fingern ist der
Sicherheitsschalter gedrückt zu halten, mit dem die Sicherheitsblockierung
der Waffenstabilisierung freigegeben wird. Mit den Zeigefingern
wird die elektrische Abfeuerung betätigt. Dazu ist der Waffenwahlschalter
nach Bedarf auf Kanone oder Turm-MG zu stellen. Mit den Daumen wird
der Taster des Laser-Entfernungsmessers auf den Innenseiten
der Richtgriffe betätigt. Links oberhalb der Richtgriffe befindet
sich ein großer roter Griff, mit dem bei Ausfall der Stromversorgung
die Kanone manuell abgefeuert werden kann. Dazu muss der rote
Griff rasch verdreht werden, wobei ein Generator soviel Strom
an den Zündstift der elektrischen Abfeuerung der Kanone abgibt,
das die Treibladung zünden kann. Gut sichtbar ist links die
Kurbel der Hydraulikpumpe der manuellen Höhenrichtanlage mit
dem roten Abfeuerungsknopf und hinter dem rechten Richtgriff
die hängende Kurbel des manuellen Seitenrichtgetriebes.
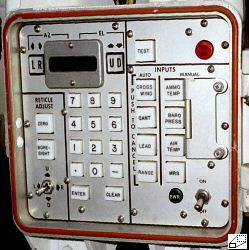 Die
Feuerleitanlage ist mit einem ballistischen Rechner gekoppelt.
Er berücksichtigt verschiedene meteorologische und ballistische
Grunddaten, die am Bedienpult bei der Vorbereitung eingegeben
werden müssen. Das Bedienfeld umfasst vier Gruppen. Eine Selbsttestgruppe
oben rechts, direkt unter dem TEST-Schalter senkrecht die Gruppe
der automatisch zu berücksichtigenden Werte Seitenwind, Verkantung,
Vorhalte und Entfernung. Bei Notwendigkeit kann die Berücksichtigung
dieser vier Werte durch drücken des entsprechenden Tasters
ausgeschaltet werden. Rechts senkrecht daneben die Wahlschaltergruppe
für die manuell einzugebenden Werte Lufttemperatur, Ladungstemperatur,
Luftdruck. Nach Auswahl eines dieser Werte kann über die Zifferneingabe
der erforderliche Wert eingegeben und durch drücken des ENTER-Tasters
im Rechner gespeichert werden. Die Ladungstemperatur der Munition
liest der Kommandant an einem Thermometer an der Trennwand zum
Turmmunitionsbunker ab. Ganz rechts unten befindet sich der
Hauptschalter des Rechners mit einer grünen Kontrollleuchte.
Links vom Zifferneingabefeld befindet sich die Bediengruppe
für die Grundjustierung des Zielfernrohres in der Vertikalen
und Horizontalen. Mit Hilfe des ZERO-Tasters kann das Strichbild
für jeder Munitionsart auf den Trefferpunkt justiert werden,
mit dem Taster BORE-SIGTH wird der Justiermodus eingeschaltet. Bei
Betriebsstörungen leuchtet ganz oben rechts die rote NO GO
Leuchte auf. Für die einzelnen Munitionsarten kann der Entfernungswert
für die Gefechtssicht eingestellt werden. Dies ist die Entfernung,
bei der mit Haltepunkt Zielmitte geschossen wird und bei der
der aufsteigende Ast der Geschossflugbahn die Zielhöhe nicht
überschreitet und der unter die Mündungswaagerechte abfallende
Ast das Ziel bis zum theoretischen Bodenaufschlagpunkt bestreicht. Die
Feuerleitanlage ist mit einem ballistischen Rechner gekoppelt.
Er berücksichtigt verschiedene meteorologische und ballistische
Grunddaten, die am Bedienpult bei der Vorbereitung eingegeben
werden müssen. Das Bedienfeld umfasst vier Gruppen. Eine Selbsttestgruppe
oben rechts, direkt unter dem TEST-Schalter senkrecht die Gruppe
der automatisch zu berücksichtigenden Werte Seitenwind, Verkantung,
Vorhalte und Entfernung. Bei Notwendigkeit kann die Berücksichtigung
dieser vier Werte durch drücken des entsprechenden Tasters
ausgeschaltet werden. Rechts senkrecht daneben die Wahlschaltergruppe
für die manuell einzugebenden Werte Lufttemperatur, Ladungstemperatur,
Luftdruck. Nach Auswahl eines dieser Werte kann über die Zifferneingabe
der erforderliche Wert eingegeben und durch drücken des ENTER-Tasters
im Rechner gespeichert werden. Die Ladungstemperatur der Munition
liest der Kommandant an einem Thermometer an der Trennwand zum
Turmmunitionsbunker ab. Ganz rechts unten befindet sich der
Hauptschalter des Rechners mit einer grünen Kontrollleuchte.
Links vom Zifferneingabefeld befindet sich die Bediengruppe
für die Grundjustierung des Zielfernrohres in der Vertikalen
und Horizontalen. Mit Hilfe des ZERO-Tasters kann das Strichbild
für jeder Munitionsart auf den Trefferpunkt justiert werden,
mit dem Taster BORE-SIGTH wird der Justiermodus eingeschaltet. Bei
Betriebsstörungen leuchtet ganz oben rechts die rote NO GO
Leuchte auf. Für die einzelnen Munitionsarten kann der Entfernungswert
für die Gefechtssicht eingestellt werden. Dies ist die Entfernung,
bei der mit Haltepunkt Zielmitte geschossen wird und bei der
der aufsteigende Ast der Geschossflugbahn die Zielhöhe nicht
überschreitet und der unter die Mündungswaagerechte abfallende
Ast das Ziel bis zum theoretischen Bodenaufschlagpunkt bestreicht.
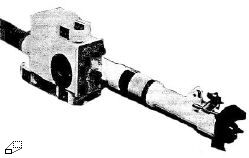 Als
Hilfszielfernrohr wird ein einfach telekopisches Gelenk-Zielfernrohr
der Firma Kollmorgen verwendet. Das Hilfszielfernrohr ist links
neben dem Hauptzielfernrohr untergebracht und mit dem Objetivteil
fest in der Walzenblende befestigt. Es besitzt eine 8fache Vergrößerung
bei einem Sichtfeld von 8 Grad. Für das Schießen mit den
zwei Hauptmunitionsarten APFSDS und HEAT ist ein Strichbildwechsler
eingebaut mit dem wahlweise das Strichbild einer Munitionsart
eingeblendet werden kann. Diese beiden Strichbilder werden durch
Leuchtdioden eingespiegelt. Zum Schutz vor Laser-Strahlung ist
ein Schutzfilter, außerdem ist ebenfalls ein Lichtfilter integriert. Als
Hilfszielfernrohr wird ein einfach telekopisches Gelenk-Zielfernrohr
der Firma Kollmorgen verwendet. Das Hilfszielfernrohr ist links
neben dem Hauptzielfernrohr untergebracht und mit dem Objetivteil
fest in der Walzenblende befestigt. Es besitzt eine 8fache Vergrößerung
bei einem Sichtfeld von 8 Grad. Für das Schießen mit den
zwei Hauptmunitionsarten APFSDS und HEAT ist ein Strichbildwechsler
eingebaut mit dem wahlweise das Strichbild einer Munitionsart
eingeblendet werden kann. Diese beiden Strichbilder werden durch
Leuchtdioden eingespiegelt. Zum Schutz vor Laser-Strahlung ist
ein Schutzfilter, außerdem ist ebenfalls ein Lichtfilter integriert.
  Ein
Windmesser auf dem Turmheck, im rechten Bild, ergänzt die Feuerleitanlage.
Bei Fehlfunktionen oder bei widrigen Windbedingungen kann der
Sensor am Messmast abgeschaltet werden. Zum Schutz vor Beschädigungen
ist der Mastfuß elastisch ausgeführt und kann bei Belastung,
wie bei Baumhindernissen, seitlich ausweichen. An der Mündung
ist der Spiegel des Mündungsreferenzsystems, auch als Feldjustieranlage
bekannt, angebracht. Am Tag wird die Kontrollmarke im Kollimator
vom Tageslicht eingeleuchtet, bei Nacht leuchtet zusätzlich
ein leicht radioaktives Tritium-Element. Bei Betätigen des Hebels
zum Feldjustieren, wird ein Prisma eingeschwenkt, wodurch über
ein Prisma die Kollimatormarke in das Sichtfeld des Hauptzielfernrohres
geschwenkt wird. Der Richtschütze kann nun die Lage der Kontrollmarke
im Kollimator mit der Hauptrichtmarke des Strichbildes im Zielfernrohr
abgleichen. Dazu ist die 10fache Vergrößerung einzuschalten.
Notwendige Korrekturen werden am Rechnerbedienpult eingegeben
und mit dem Drücken der ENTER-Taste fest im Speicher abgelegt. Ein
Windmesser auf dem Turmheck, im rechten Bild, ergänzt die Feuerleitanlage.
Bei Fehlfunktionen oder bei widrigen Windbedingungen kann der
Sensor am Messmast abgeschaltet werden. Zum Schutz vor Beschädigungen
ist der Mastfuß elastisch ausgeführt und kann bei Belastung,
wie bei Baumhindernissen, seitlich ausweichen. An der Mündung
ist der Spiegel des Mündungsreferenzsystems, auch als Feldjustieranlage
bekannt, angebracht. Am Tag wird die Kontrollmarke im Kollimator
vom Tageslicht eingeleuchtet, bei Nacht leuchtet zusätzlich
ein leicht radioaktives Tritium-Element. Bei Betätigen des Hebels
zum Feldjustieren, wird ein Prisma eingeschwenkt, wodurch über
ein Prisma die Kollimatormarke in das Sichtfeld des Hauptzielfernrohres
geschwenkt wird. Der Richtschütze kann nun die Lage der Kontrollmarke
im Kollimator mit der Hauptrichtmarke des Strichbildes im Zielfernrohr
abgleichen. Dazu ist die 10fache Vergrößerung einzuschalten.
Notwendige Korrekturen werden am Rechnerbedienpult eingegeben
und mit dem Drücken der ENTER-Taste fest im Speicher abgelegt.
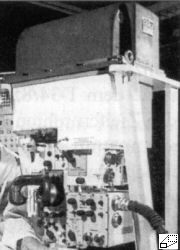 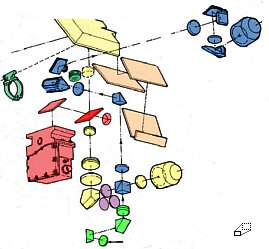 Abschließend
noch ein Blick auf den Aufbau des Hauptzielfernrohres. Das linke
Bild zeigt ein Foto des Herstellers auf den ausgebauten Zielfernrohrblock.
Oben ist angebracht die Baugruppe der Ziellinienstabilisierung
mit dem Kopfspiegel aus einer hochpolierten Aluminiumlegierung.
Darunter befindet sich die optische Baugruppe für die Zusammenführung
der Kanäle des Tagkanals, des Wärmebildkanals, des Kanals des
Laserentfernungsmessers, der Kanal zum Kommandanteneinblick
und der Kanal für die Feldjustieranlage. Daran schließen sich
die elektrischen und mechanischen Bedienelemente an. Das
rechte Bild zeigt die Strahlenverläufe des optischen Systems
des Hauptzielfernrohres. Über die vertikal stabilisierte Kopfspiegelbaugruppe
(gelb) mit dem Spiegel aus poliertem Aluminium verlaufen
alle Strahlengänge. Ebenfalls gelb eingefärbt ist der Tagsichtkanal
zum Okular des Hauptzielfernrohr. Durch ein Strahlenteilerprisma
(blau) wird das vollständige Sichtfeld des Richtschützen
über einen optischen Kanal (blau) zum Einblick des Kommandanten
umgeleitet. Über das gleiche Strahlenteilerprisma (blau)
wird ebenfalls das sichtbare Bild aus dem Wärmebildmodul (grün)
in das Sichtfeld des Zielfernrohres eingespiegelt. Mit Hilfe
einer einschwenkbaren Linsengruppe (dunkelgrün) wird
im Sichtfeld des Zielfernrohres die Kontrollmarke des Kollimators
der Feldjustieranlage an der Kanonenmündung sichtbar gemacht.
Schließlich ist es möglich, durch ein Spiegelsystem (orange)
eine unvergrößerte stabilisierten Sicht auf das Gelände zu erhalten.
Das Modul des Laser-Entfernungsmessers (rot) an der linken
Seite dient neben der Entfernungsmessung auch der Einleuchtung
des Strichbildes. Dazu wird das Strichbild über den schwenkbaren
halbdurchlässigen Spiegel (dunkelrot) und einen dahinterliegenden
weiteren Spiegel in das Sichtfeld eingespiegelt. Der schwenkbare
halbdurchlässige Spiegel wird von der automatischen Feuerleitanlage
gesteuert. Dazu wird eine Fotodiode entsprechend der ermittelten
Vorhalte seitlich verschoben. Die Fotodiode empfängt einen Lichtstrahl
aus einer Leuchtdiode, deren Lichtstrahl über den beweglichen
Spiegel auf die Fotodiode fällt. Das seitliche Verschieben der
Fotodiode führt zu einem automatischen Nachregeln der Spiegelstellung
durch die Feuerleitanlage, bis der Lichtstrahl wieder mittig
auf die Fotodiode trifft, während gleichzeitig der Turm horizontal
entgegengesetzt um den Winkel der Vorhalte verdreht wird. Nach
dem gleichen Prinzip erfolgt die Stabilisierung der Visierlinie
in der horizontalen Ebene. Ein Kreisel für die horizontale Ebene
in der Baugruppe der Kopfspiegelstabilisierung gibt ein Signal
aus, auf dessen Grundlage in bestimmten Grenzen, ebenfalls wieder
über die Verschiebung der Fotodiode, der Spiegel nachgerichtet
und der Turm entgegengesetzt verdreht wird. Allerdings ist das
Ziel der Entwickler, eine einfachere Konstruktion zu schaffen,
nicht erreicht worden. Die Leistungsparameter liegen deutlich
unter denen des Zielfernrohres, zum Beispiel, des Leopard 2.
Allerdings, bei Hinnahme eines leichten seitlichen Zitterns
des Strichbildes, kann mit dem Zielfernrohr des M1 durch geübte
Richtschützen ausreichend genau geschossen werden. Im Rahmen
der Modernisierung wurde in das Zielfernrohr des M1A2 eine echte
Stabilisierung der Visierlinie in zwei Ebenen eingeführt.
Abschließend
noch ein Blick auf den Aufbau des Hauptzielfernrohres. Das linke
Bild zeigt ein Foto des Herstellers auf den ausgebauten Zielfernrohrblock.
Oben ist angebracht die Baugruppe der Ziellinienstabilisierung
mit dem Kopfspiegel aus einer hochpolierten Aluminiumlegierung.
Darunter befindet sich die optische Baugruppe für die Zusammenführung
der Kanäle des Tagkanals, des Wärmebildkanals, des Kanals des
Laserentfernungsmessers, der Kanal zum Kommandanteneinblick
und der Kanal für die Feldjustieranlage. Daran schließen sich
die elektrischen und mechanischen Bedienelemente an. Das
rechte Bild zeigt die Strahlenverläufe des optischen Systems
des Hauptzielfernrohres. Über die vertikal stabilisierte Kopfspiegelbaugruppe
(gelb) mit dem Spiegel aus poliertem Aluminium verlaufen
alle Strahlengänge. Ebenfalls gelb eingefärbt ist der Tagsichtkanal
zum Okular des Hauptzielfernrohr. Durch ein Strahlenteilerprisma
(blau) wird das vollständige Sichtfeld des Richtschützen
über einen optischen Kanal (blau) zum Einblick des Kommandanten
umgeleitet. Über das gleiche Strahlenteilerprisma (blau)
wird ebenfalls das sichtbare Bild aus dem Wärmebildmodul (grün)
in das Sichtfeld des Zielfernrohres eingespiegelt. Mit Hilfe
einer einschwenkbaren Linsengruppe (dunkelgrün) wird
im Sichtfeld des Zielfernrohres die Kontrollmarke des Kollimators
der Feldjustieranlage an der Kanonenmündung sichtbar gemacht.
Schließlich ist es möglich, durch ein Spiegelsystem (orange)
eine unvergrößerte stabilisierten Sicht auf das Gelände zu erhalten.
Das Modul des Laser-Entfernungsmessers (rot) an der linken
Seite dient neben der Entfernungsmessung auch der Einleuchtung
des Strichbildes. Dazu wird das Strichbild über den schwenkbaren
halbdurchlässigen Spiegel (dunkelrot) und einen dahinterliegenden
weiteren Spiegel in das Sichtfeld eingespiegelt. Der schwenkbare
halbdurchlässige Spiegel wird von der automatischen Feuerleitanlage
gesteuert. Dazu wird eine Fotodiode entsprechend der ermittelten
Vorhalte seitlich verschoben. Die Fotodiode empfängt einen Lichtstrahl
aus einer Leuchtdiode, deren Lichtstrahl über den beweglichen
Spiegel auf die Fotodiode fällt. Das seitliche Verschieben der
Fotodiode führt zu einem automatischen Nachregeln der Spiegelstellung
durch die Feuerleitanlage, bis der Lichtstrahl wieder mittig
auf die Fotodiode trifft, während gleichzeitig der Turm horizontal
entgegengesetzt um den Winkel der Vorhalte verdreht wird. Nach
dem gleichen Prinzip erfolgt die Stabilisierung der Visierlinie
in der horizontalen Ebene. Ein Kreisel für die horizontale Ebene
in der Baugruppe der Kopfspiegelstabilisierung gibt ein Signal
aus, auf dessen Grundlage in bestimmten Grenzen, ebenfalls wieder
über die Verschiebung der Fotodiode, der Spiegel nachgerichtet
und der Turm entgegengesetzt verdreht wird. Allerdings ist das
Ziel der Entwickler, eine einfachere Konstruktion zu schaffen,
nicht erreicht worden. Die Leistungsparameter liegen deutlich
unter denen des Zielfernrohres, zum Beispiel, des Leopard 2.
Allerdings, bei Hinnahme eines leichten seitlichen Zitterns
des Strichbildes, kann mit dem Zielfernrohr des M1 durch geübte
Richtschützen ausreichend genau geschossen werden. Im Rahmen
der Modernisierung wurde in das Zielfernrohr des M1A2 eine echte
Stabilisierung der Visierlinie in zwei Ebenen eingeführt.
 Das letzte Bild zeigt die Baugruppe des Wärmebildgerätes.
Über die Linsengruppe des Teleskops (gelb) empfängt
das Wärmebildmodul die IR-Strahlung. Es schließt sich der IR-Imager (rot)
an, sowie der Scannerspiegel (dunkelrot), der das empfangene
Bild zeilenweise abtastet und die Bildzeilen auf den IR-Detektor
(grün) sendet. Der Detektor wird von einem Kühler (blau)
auf
-196 Grad Celsius heruntergekühlt. Die rechts oben gezeigte
Elektronikbaugruppe enthält den Videomixer, den Video-Controler,
einen Vor- und Nachverstärker sowie weitere elektronische Bauteile.
Darunter (orange) ist die Bedieneinheit dargestellt,
die auch die Baugruppe zur Erzeugung des sichtbaren Bildes enthält
und dieses Bild über eine Prismenbaugruppe, im Bild weiter oben
grün dargestellt, in das Sichtfeld des Zielfernrohres einspiegelt.
Die Stromversorgungseinheit, nicht dargestellt, stellt die notwendigen
Spannungen aus dem Bordnetz zur Verfügung Das letzte Bild zeigt die Baugruppe des Wärmebildgerätes.
Über die Linsengruppe des Teleskops (gelb) empfängt
das Wärmebildmodul die IR-Strahlung. Es schließt sich der IR-Imager (rot)
an, sowie der Scannerspiegel (dunkelrot), der das empfangene
Bild zeilenweise abtastet und die Bildzeilen auf den IR-Detektor
(grün) sendet. Der Detektor wird von einem Kühler (blau)
auf
-196 Grad Celsius heruntergekühlt. Die rechts oben gezeigte
Elektronikbaugruppe enthält den Videomixer, den Video-Controler,
einen Vor- und Nachverstärker sowie weitere elektronische Bauteile.
Darunter (orange) ist die Bedieneinheit dargestellt,
die auch die Baugruppe zur Erzeugung des sichtbaren Bildes enthält
und dieses Bild über eine Prismenbaugruppe, im Bild weiter oben
grün dargestellt, in das Sichtfeld des Zielfernrohres einspiegelt.
Die Stromversorgungseinheit, nicht dargestellt, stellt die notwendigen
Spannungen aus dem Bordnetz zur Verfügung
Vielen Dank an Jan
Willem de Boer aus den Niederlanden
für die Fotos.
Weitere Fotos vom M1A1 sind auf der Homepage
von Tanxheaven
veröffentlicht.
Part 1
Part
2
|



 Die
Bedienelemente des Hauptzielfernrohres zeigt das linke Bild.
Oberhalb des Okulars befindet sich die Umschaltung der
Die
Bedienelemente des Hauptzielfernrohres zeigt das linke Bild.
Oberhalb des Okulars befindet sich die Umschaltung der  Das
Modul des Laser-Entfernungsmessers ist hängend links am Hauptzielfernrohrgehäuse
befestigt. Es befindet sich nur ein Bedienelement darauf, ein
Dreistellungsschalter. In Mittelstellung ist der Entfernungsmesser
ausgeschaltet, in den weiteren Stellungen ist der Laser scharfgeschaltet.
In der Stellung ARM LAST RTN berücksichtigt der Laser nur den
letzten reflektierten Laserstrahl, in der Stellung ARM 1ST RTN
nur den ersten reflektierten Laserstrahl. Dadurch können je
nach Geländebedingungen Fehlmessungen durch Mehrfachreflektionen
vermieden werden. Der Messbereich des Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat-Lasers beträgt 200 bis 7990 Meter, bei einer Messgenauigkeit
von ±10 Metern. Entfernungen oberhalb 4000 Metern werden nicht
mehr automatisch in den ballistischen Rechner übergeben. Die
Entfernung wird 4stellig im Okular angezeigt. Betriebsstörungen
werden mit dem Symbol F rechts oberhalb der Entfernungsanzeige
signalisiert. Ein waagerechter Strich über der Entfernungsanzeige
wird eingeleuchtet, wenn Mehrfachreflektionen auftreten. Bei
Fehlmessungen blinkt die Entfernungsanzeige mit vier Nullen
auf. Zusätzlich übernimmt das Entfernungsmessermodul die Aufgabe
ein rötliches Strichbild über einen Strahlenteiler und Prismen in
den Strahlengang des Okulars einzuleuchten. Der bewegliche Strahlenteiler
dient dazu, das Strichbild horizontal auszulenken, um notwendige
Vorhalten für bewegliche Ziele zur berücksichtigen. Diese Doppelfunktion
gewährleistet auch, dass die Entfernungsmessmarke immer mit
dem Zentrum des Strichbildes zusammenfällt.
Das
Modul des Laser-Entfernungsmessers ist hängend links am Hauptzielfernrohrgehäuse
befestigt. Es befindet sich nur ein Bedienelement darauf, ein
Dreistellungsschalter. In Mittelstellung ist der Entfernungsmesser
ausgeschaltet, in den weiteren Stellungen ist der Laser scharfgeschaltet.
In der Stellung ARM LAST RTN berücksichtigt der Laser nur den
letzten reflektierten Laserstrahl, in der Stellung ARM 1ST RTN
nur den ersten reflektierten Laserstrahl. Dadurch können je
nach Geländebedingungen Fehlmessungen durch Mehrfachreflektionen
vermieden werden. Der Messbereich des Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat-Lasers beträgt 200 bis 7990 Meter, bei einer Messgenauigkeit
von ±10 Metern. Entfernungen oberhalb 4000 Metern werden nicht
mehr automatisch in den ballistischen Rechner übergeben. Die
Entfernung wird 4stellig im Okular angezeigt. Betriebsstörungen
werden mit dem Symbol F rechts oberhalb der Entfernungsanzeige
signalisiert. Ein waagerechter Strich über der Entfernungsanzeige
wird eingeleuchtet, wenn Mehrfachreflektionen auftreten. Bei
Fehlmessungen blinkt die Entfernungsanzeige mit vier Nullen
auf. Zusätzlich übernimmt das Entfernungsmessermodul die Aufgabe
ein rötliches Strichbild über einen Strahlenteiler und Prismen in
den Strahlengang des Okulars einzuleuchten. Der bewegliche Strahlenteiler
dient dazu, das Strichbild horizontal auszulenken, um notwendige
Vorhalten für bewegliche Ziele zur berücksichtigen. Diese Doppelfunktion
gewährleistet auch, dass die Entfernungsmessmarke immer mit
dem Zentrum des Strichbildes zusammenfällt. 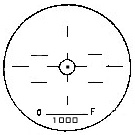 Der
Aufbau des Strichbildes entspricht dem bisherigen Standard für
Zielfernrohre. Ziele werden mit dem zentralen Kreuz angerichtet.
Der Punkt in der Mitte des Kreises entspricht der Laser-Messmarke.
Die senkrechten und waagerechten Striche dienen als Hilfsrichtmarken
zur Berücksichtigung von Vorhalten und zur Korrektur des Feuers
bei Ausfall der automatischen Feuerleitanlage.
Der
Aufbau des Strichbildes entspricht dem bisherigen Standard für
Zielfernrohre. Ziele werden mit dem zentralen Kreuz angerichtet.
Der Punkt in der Mitte des Kreises entspricht der Laser-Messmarke.
Die senkrechten und waagerechten Striche dienen als Hilfsrichtmarken
zur Berücksichtigung von Vorhalten und zur Korrektur des Feuers
bei Ausfall der automatischen Feuerleitanlage. Dieses Bild zeigt einen Blick auf die Richtgriffe der
Dieses Bild zeigt einen Blick auf die Richtgriffe der 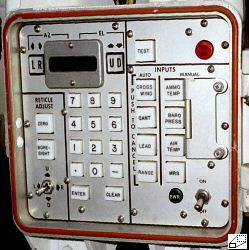
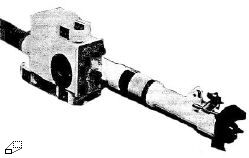


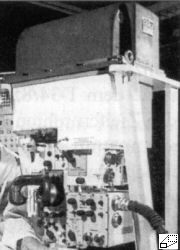
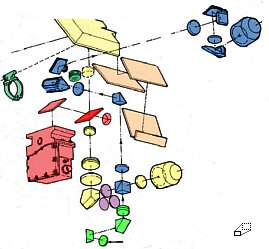
 Das letzte Bild zeigt die Baugruppe des Wärmebildgerätes.
Über die Linsengruppe des Teleskops (gelb) empfängt
das Wärmebildmodul die IR-Strahlung. Es schließt sich der IR-Imager (rot)
an, sowie der Scannerspiegel (dunkelrot), der das empfangene
Bild zeilenweise abtastet und die Bildzeilen auf den IR-Detektor
(grün) sendet. Der Detektor wird von einem Kühler (blau)
auf
-196 Grad Celsius heruntergekühlt. Die rechts oben gezeigte
Elektronikbaugruppe enthält den Videomixer, den Video-Controler,
einen Vor- und Nachverstärker sowie weitere elektronische Bauteile.
Darunter (orange) ist die Bedieneinheit dargestellt,
die auch die Baugruppe zur Erzeugung des sichtbaren Bildes enthält
und dieses Bild über eine Prismenbaugruppe, im Bild weiter oben
grün dargestellt, in das Sichtfeld des Zielfernrohres einspiegelt.
Die Stromversorgungseinheit, nicht dargestellt, stellt die notwendigen
Spannungen aus dem Bordnetz zur Verfügung
Das letzte Bild zeigt die Baugruppe des Wärmebildgerätes.
Über die Linsengruppe des Teleskops (gelb) empfängt
das Wärmebildmodul die IR-Strahlung. Es schließt sich der IR-Imager (rot)
an, sowie der Scannerspiegel (dunkelrot), der das empfangene
Bild zeilenweise abtastet und die Bildzeilen auf den IR-Detektor
(grün) sendet. Der Detektor wird von einem Kühler (blau)
auf
-196 Grad Celsius heruntergekühlt. Die rechts oben gezeigte
Elektronikbaugruppe enthält den Videomixer, den Video-Controler,
einen Vor- und Nachverstärker sowie weitere elektronische Bauteile.
Darunter (orange) ist die Bedieneinheit dargestellt,
die auch die Baugruppe zur Erzeugung des sichtbaren Bildes enthält
und dieses Bild über eine Prismenbaugruppe, im Bild weiter oben
grün dargestellt, in das Sichtfeld des Zielfernrohres einspiegelt.
Die Stromversorgungseinheit, nicht dargestellt, stellt die notwendigen
Spannungen aus dem Bordnetz zur Verfügung